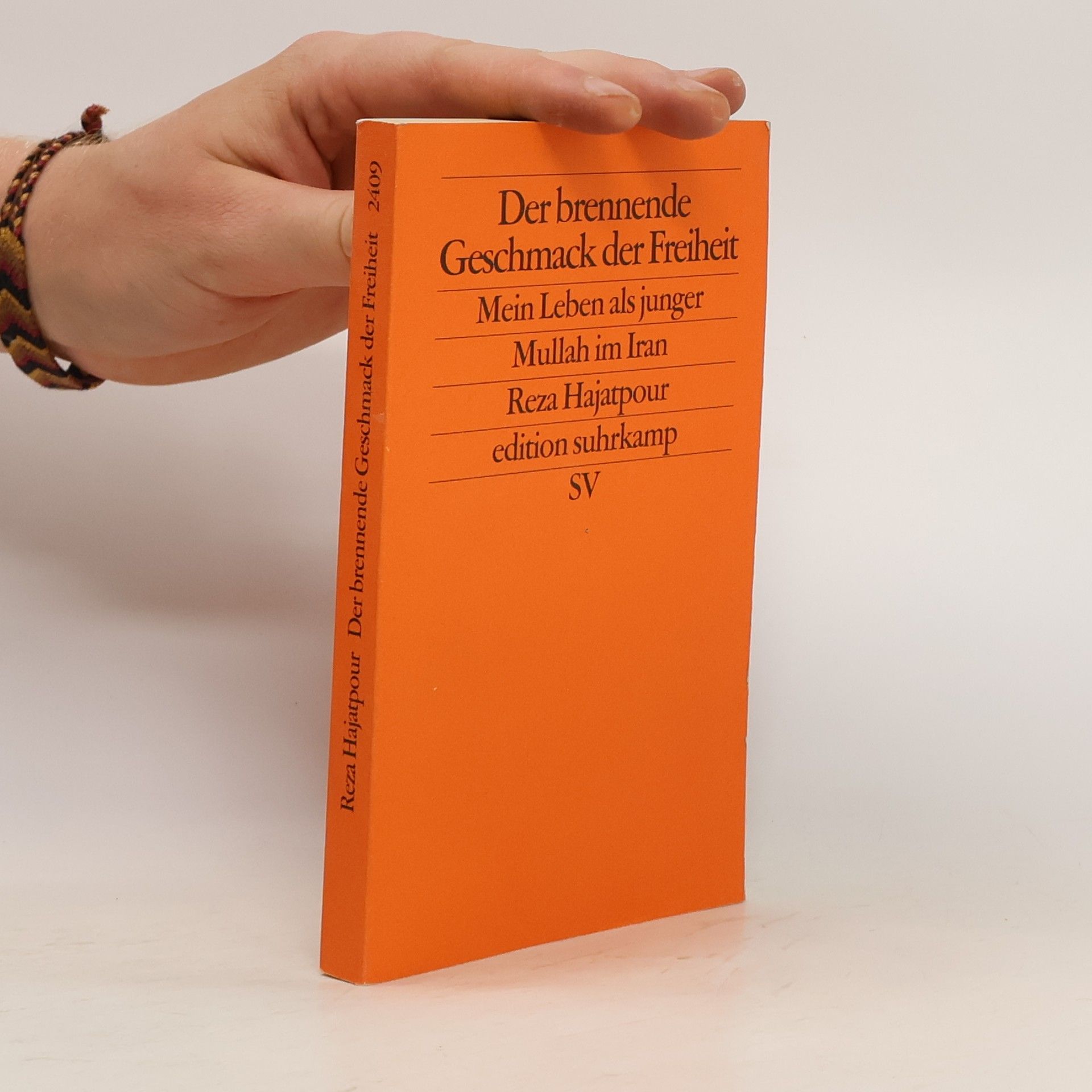Der brennende Geschmack der Freiheit
Mein Leben als junger Mullah im Iran
In eindringlicher und zugleich poetischer Sprache beschreibt Hajatpour die Konflikte, die ihn als jungen Mullah mit fast unlösbaren Fragen an den Islam konfrontieren und sein Vertrauen gegenüber Familie und Freunden erschüttern. Seine Autobiographie eröffnet einen faszinierenden Einblick in das Leben und den Alltag eines Geistlichen unter der absolutistischen Herrschaft Khomeinis – in eine Gesellschaft, in der Religiosität unentwegt mit Politik verbunden ist.