Der dreibändige "Grundkurs" verbindet wissenschaftliche Exaktheit auf dem neuesten Stand der Forschung mit anschaulicher Sprache nebst einer Fülle zeitgenössischer Abbildungen zu einem einzigartigen Wegbegleiter durch nahezu tausend Jahre deutscher Militärgeschichte. Überblick, Umfeld, Strukturen und Konflikte sind die Grundlagen für vier verschiedene Zugänge zu jedem der insgesamt zwölf Epochenabschnitte. Namhafte Wissenschaftler zeichnen die grundlegenden Entwicklungslinien vom Mittelalter bis in die Gegenwart nach und beschreiben das mitunter spannungsreiche Verhältnis von Militär, Politik, Staat und Gesellschaft. Eine Vielzahl von Quellentexten, Karten, Grafiken, Tabellen, Biogrammen und Sachtexten belebt die Epochenabschnitte und erfüllt zugleich die Funktion eines militärgeschichtlichen Nachschlagewerkes. Der Grundkurs gibt eine umfassende Orientierung, lädt ein zu einem Streifzug durch die ereignisreiche deutsche Militärgeschichte und kombiniert Leselust mit Lerneffekt.
Gerhard P. Groß Boeken



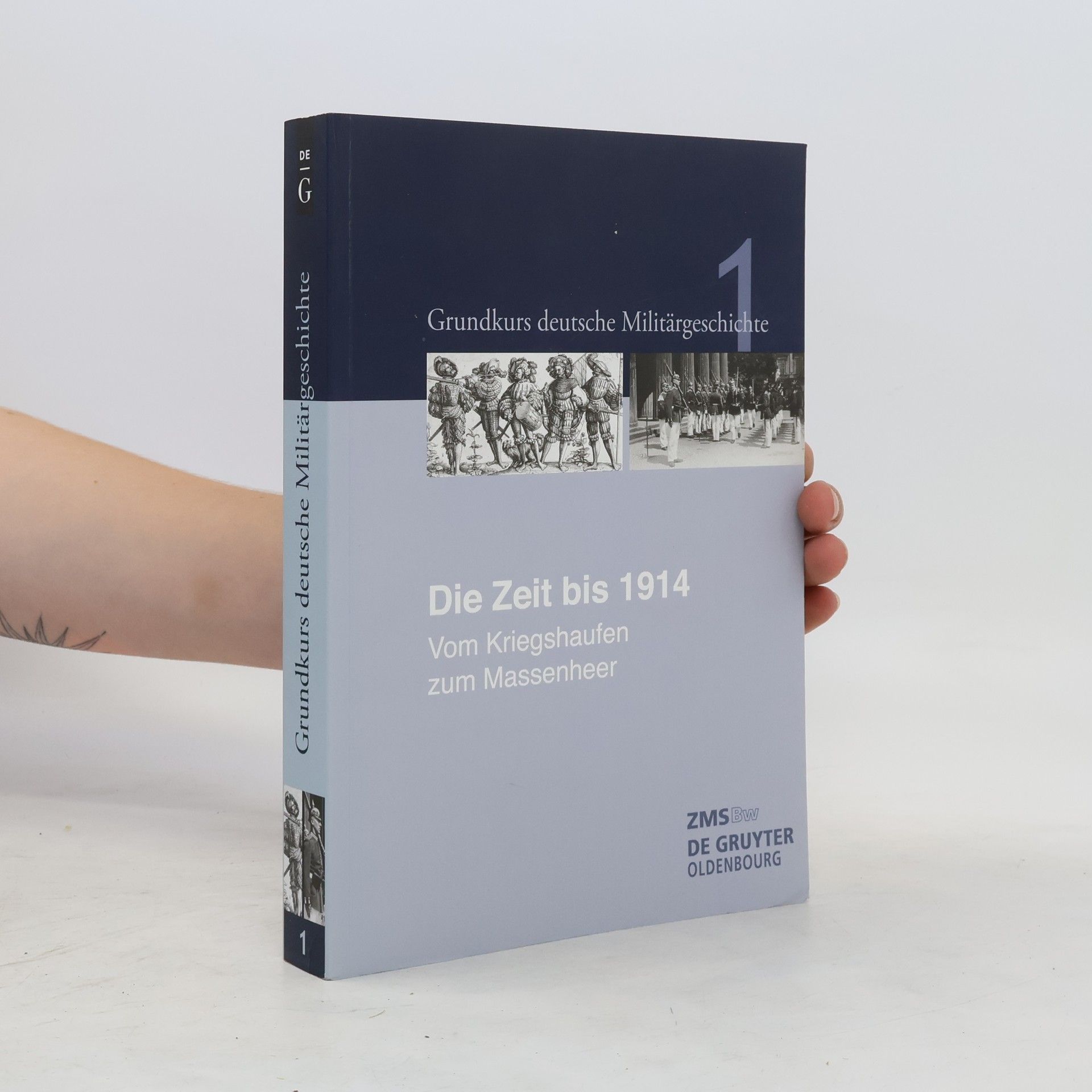
Das Zeitalter der Weltkriege
Grundkurs deutsche Militärgeschichte 2
1914 trat Deutschland mit dem Großen Hauptquartier als zentralem Führungsinstrument in den Krieg ein. In ihm versammelten sich neben Kaiser Wilhelm II. die wichtigsten politischen und militärischen Entscheidungsträger des Kaiserreichs. Diese Studie fragt nicht nur danach, was das Große Hauptquartier war, sondern wie in ihm Führung organisiert wurde, wie Entscheidungsprozesse abliefen und wie modern es war. Vieles, wenn nicht alles, hing vom Kaiser ab. Würde und konnte er seiner Verantwortung gerecht werden? Konnte er die divergierenden Interessen zwischen den Kabinetten, der Heeres- und Marineführung sowie dem Reichskanzler bündeln? Konnte er überhaupt führen? Die Studie von Gerhard P. Groß geht weit über eine Organisationsgeschichte hinaus. Sie ist zugleich ein institutionelles Psychogramm, das die Lebensrealität im GrHQ abbildet und untersucht, welche Einflüsse der Alltag auf Führungsentscheidungen hatte – wie das GrHQ funktionierte.
Bis 1918 waren die Soldaten wie auch die Bevölkerung des Deutschen Kaiserreichs noch überzeugt, dass ihr Sieg im Ersten Weltkrieg unmittelbar bevorstehe. Doch mit der Schlacht bei Amiens wendete sich das Blatt, nicht zuletzt weil aufseiten der Alliierten erstmals zahlreiche Panzer zum Einsatz kamen. Deutschland musste im Herbst 1918 kapitulieren, während sich im Hintergrund die Novemberrevolution zusammenbraute. In der sogenannten »Dolchstoßlegende« wurde die militärische Niederlage später auf die politische Unruhe im Land zurückgeführt. Warum es sich dabei um einen Mythos handelt und welche Umstände wirklich zum Scheitern des Kaiserreichs führten, erhellt dieses Buch. Die Reihe Kriege der Moderne , herausgegeben vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, stellt die wichtigsten militärischen Konflikte des 19. und 20. Jahrhunderts nach modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen vor und erläutert ihre geschichtlichen Ursachen und politischen Folgen.