WORK IN PROGRESS. WORK ON PROGRESS.
10 Jahre Beiträge kritischer Wissenschaft: Doktorand*innen Jahrbuch 2020 der Rosa-Luxemburg-Stiftung


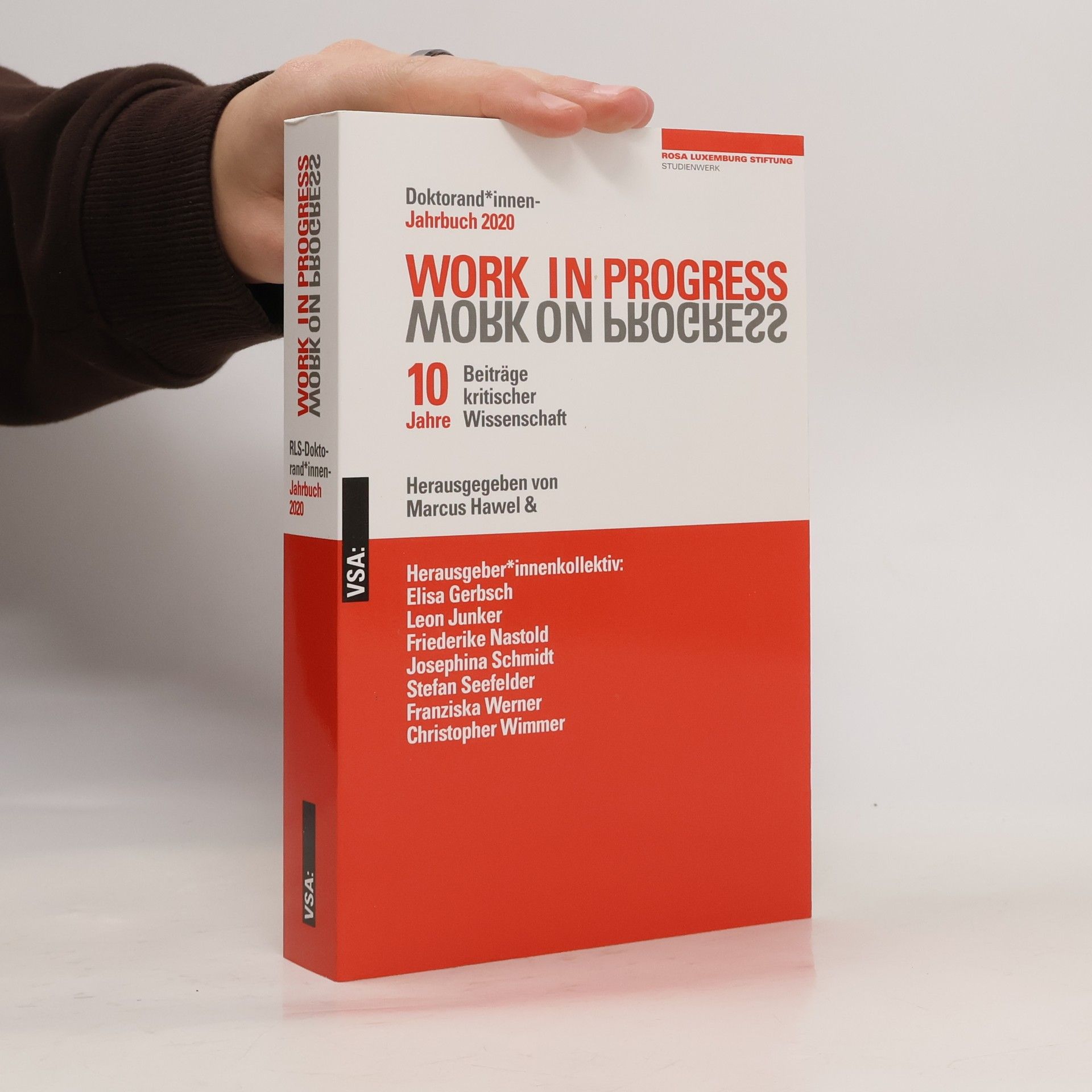
10 Jahre Beiträge kritischer Wissenschaft: Doktorand*innen Jahrbuch 2020 der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Politische Bildung in einer zerrissenen Gesellschaft