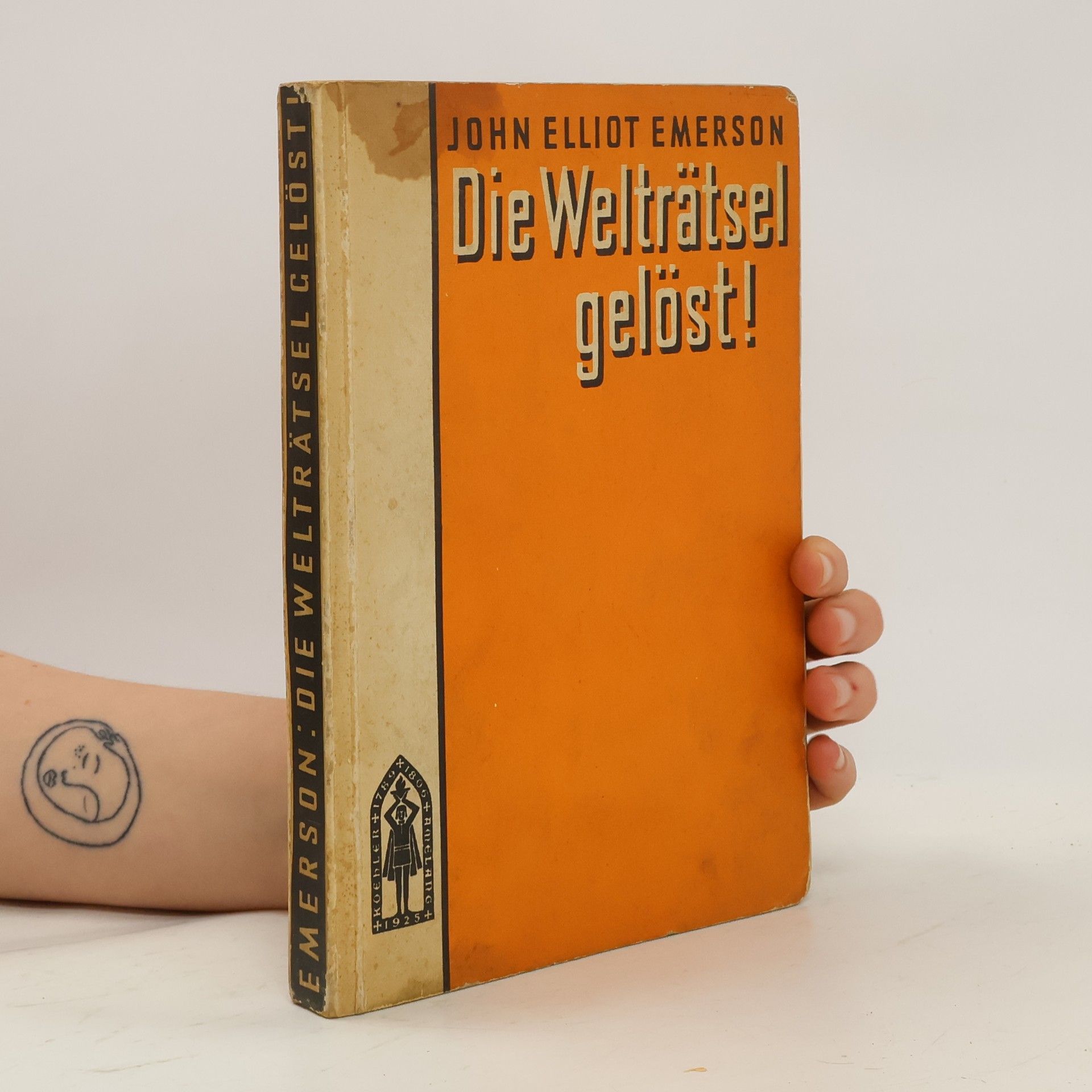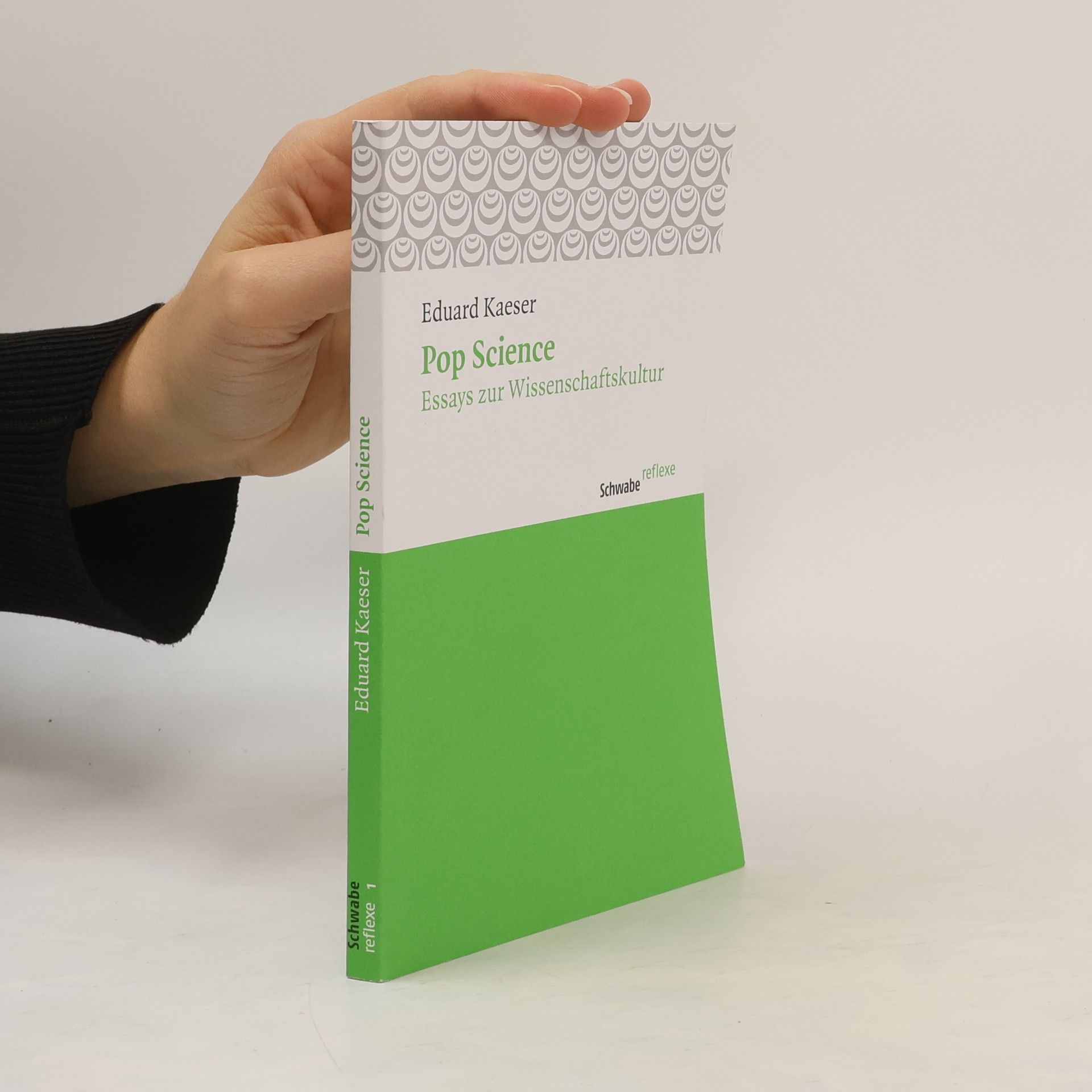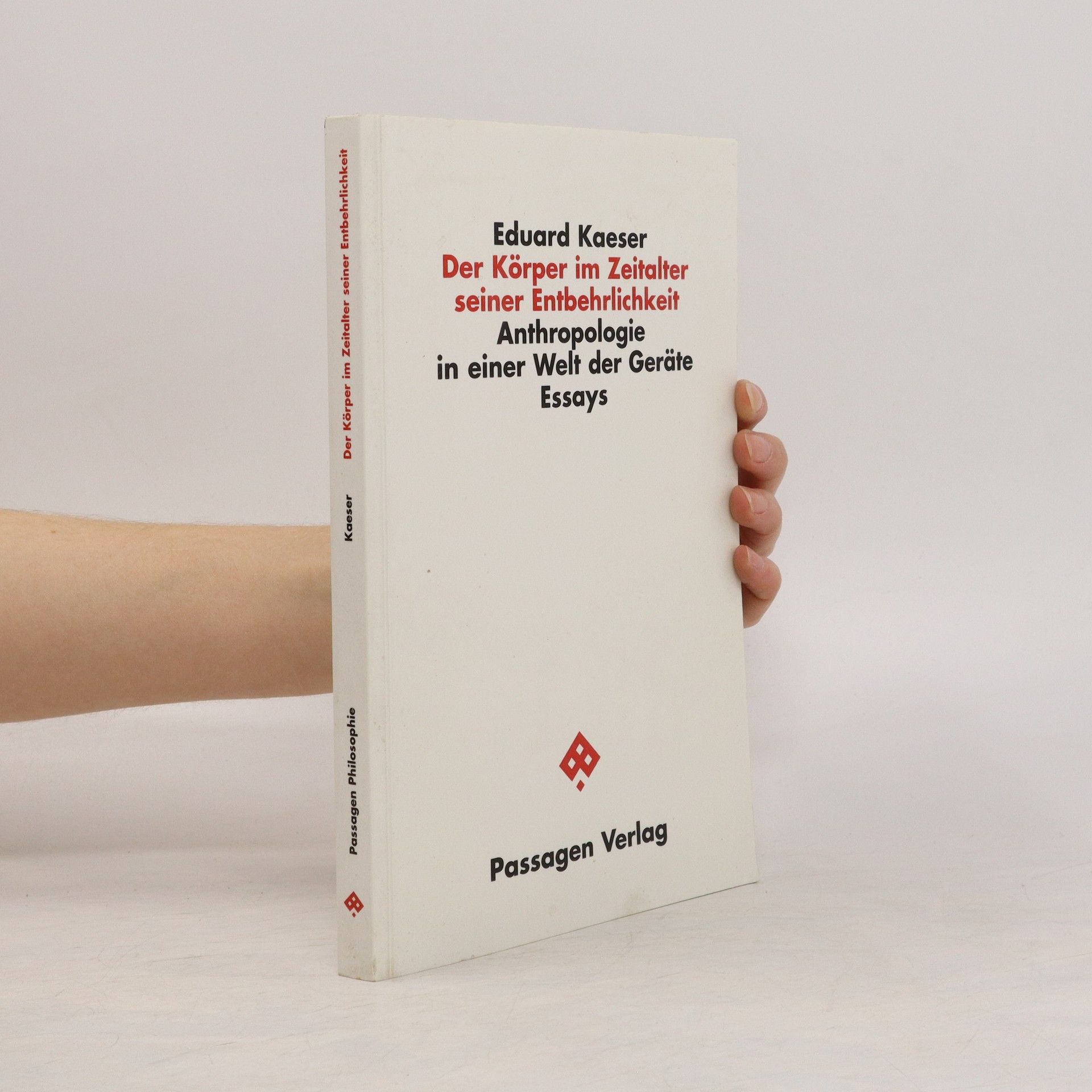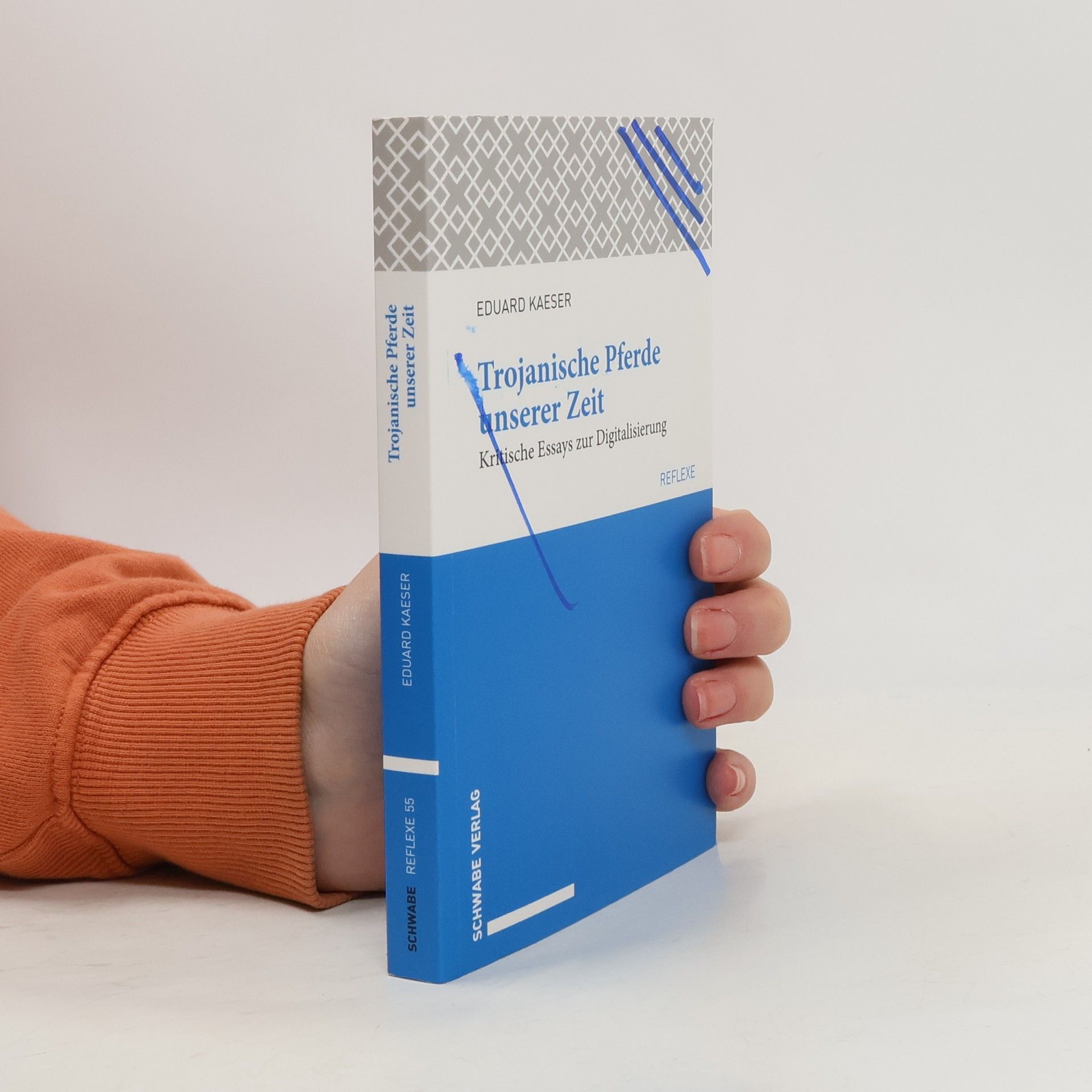Die Erde ist eine Keimträgerin
Lehren aus der Corona-Pandemie
Das Virus hat uns kalt erwischt. Bisher richteten wir unser alarmiertes Augenmerk auf die Makro-Skala des Klimawandels und vernachlassigten straflich die organische Mikro-Skala im gesamtplanetarischen oikos, dem Haushalt der Erde. Jetzt stellt sich heraus: Unser Planet ist ein gewaltiger Keimtrager. Und okologisch denken bedeutet, auch mit den kleinsten Mitbewohnern zu rechnen. Die Mikrobe kann deshalb als Metapher dienen fur die Macht des Zufalls; die begrenzte Operationsfahigkeit des Menschen; das unbekannte Unbekannte; das Fremde, Invasive; die Kontamination, den Dreck. Es ist an der Zeit, sich auch philosophisch mit diesen Stellgrossen des kunftigen planetarischen Lebens auseinanderzusetzen. Die Realitat, in der wir leben, ist total viral.