Neuausgabe. ( Syndikat-Reprise). 419 S. 3. A.
Rolf Schwendter Boeken
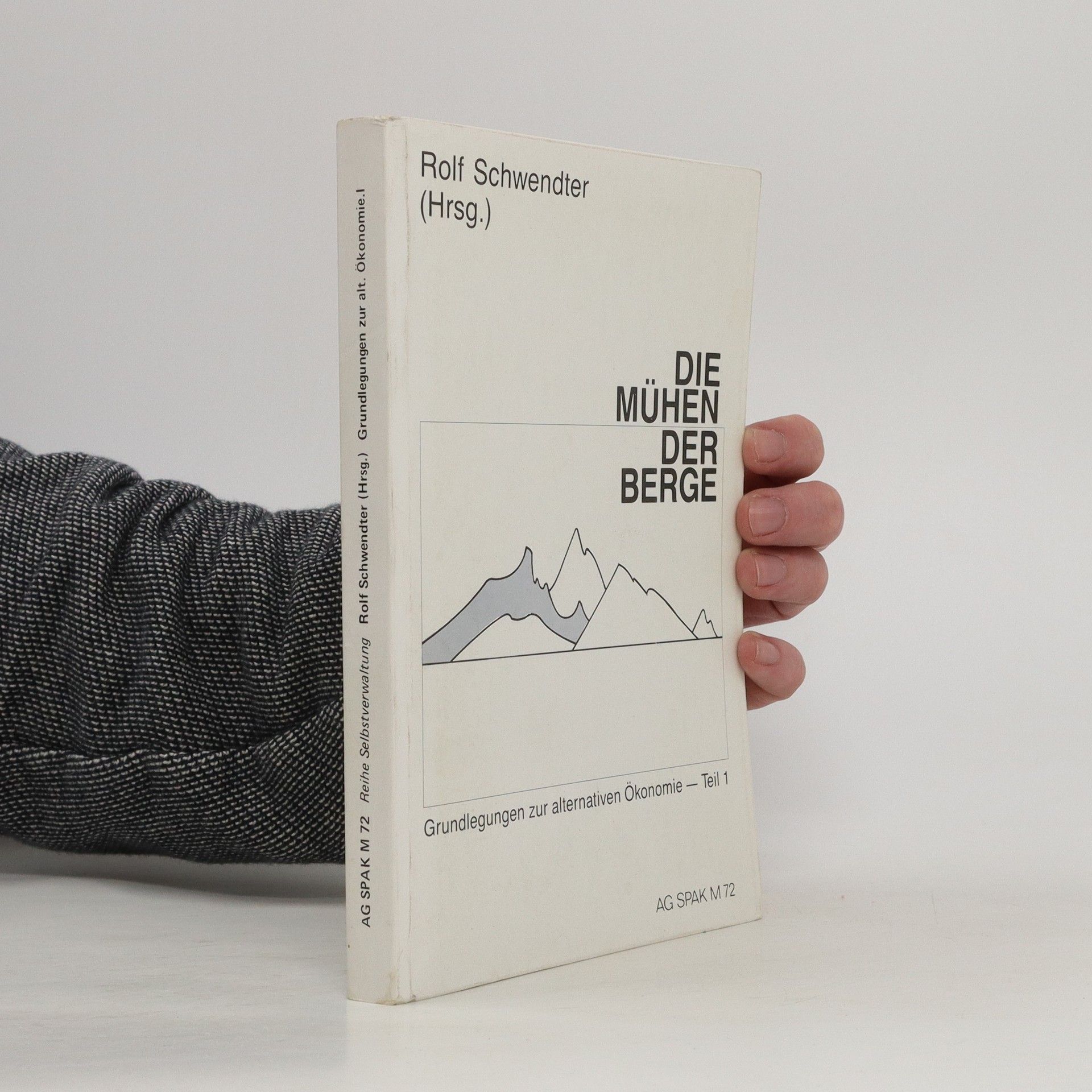
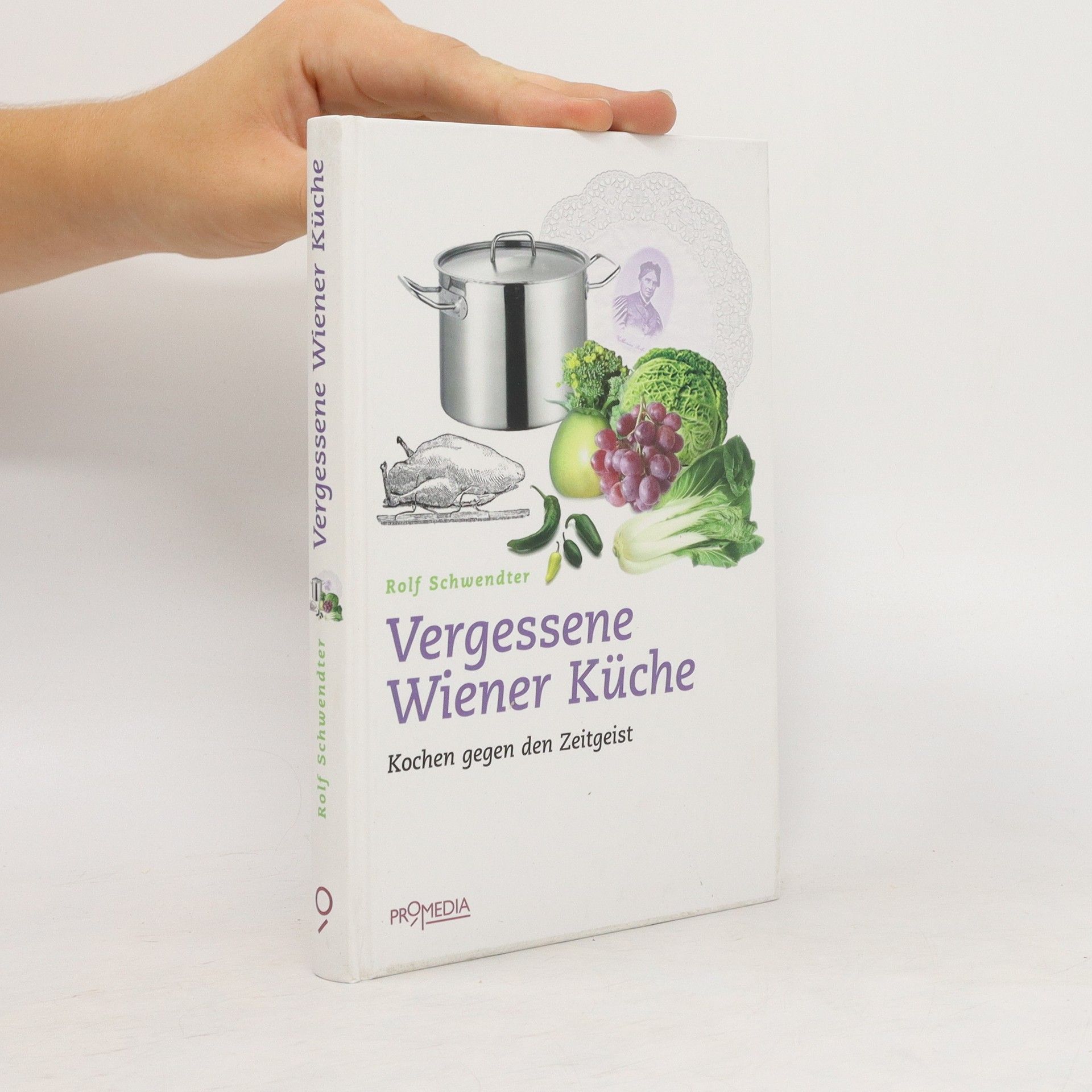
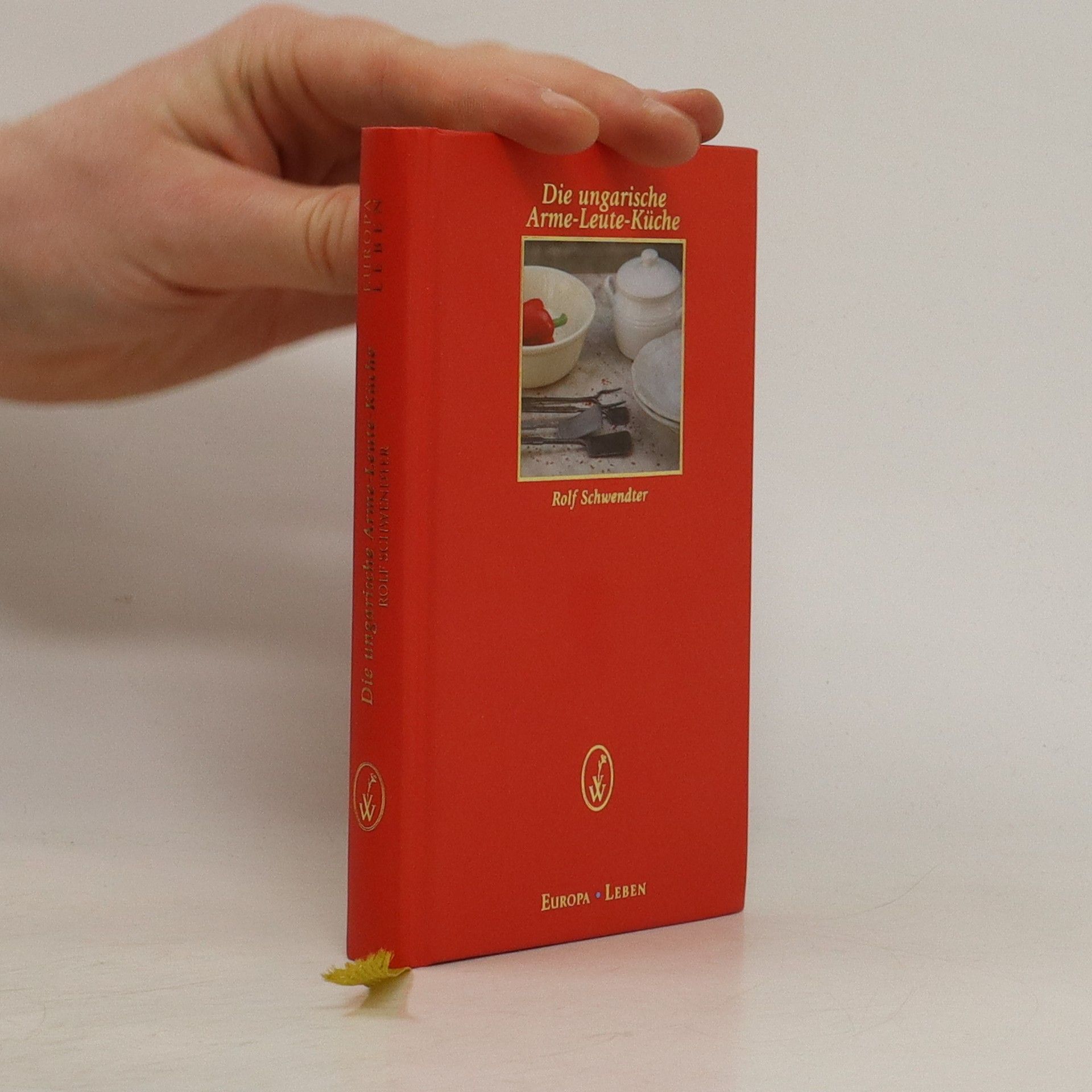
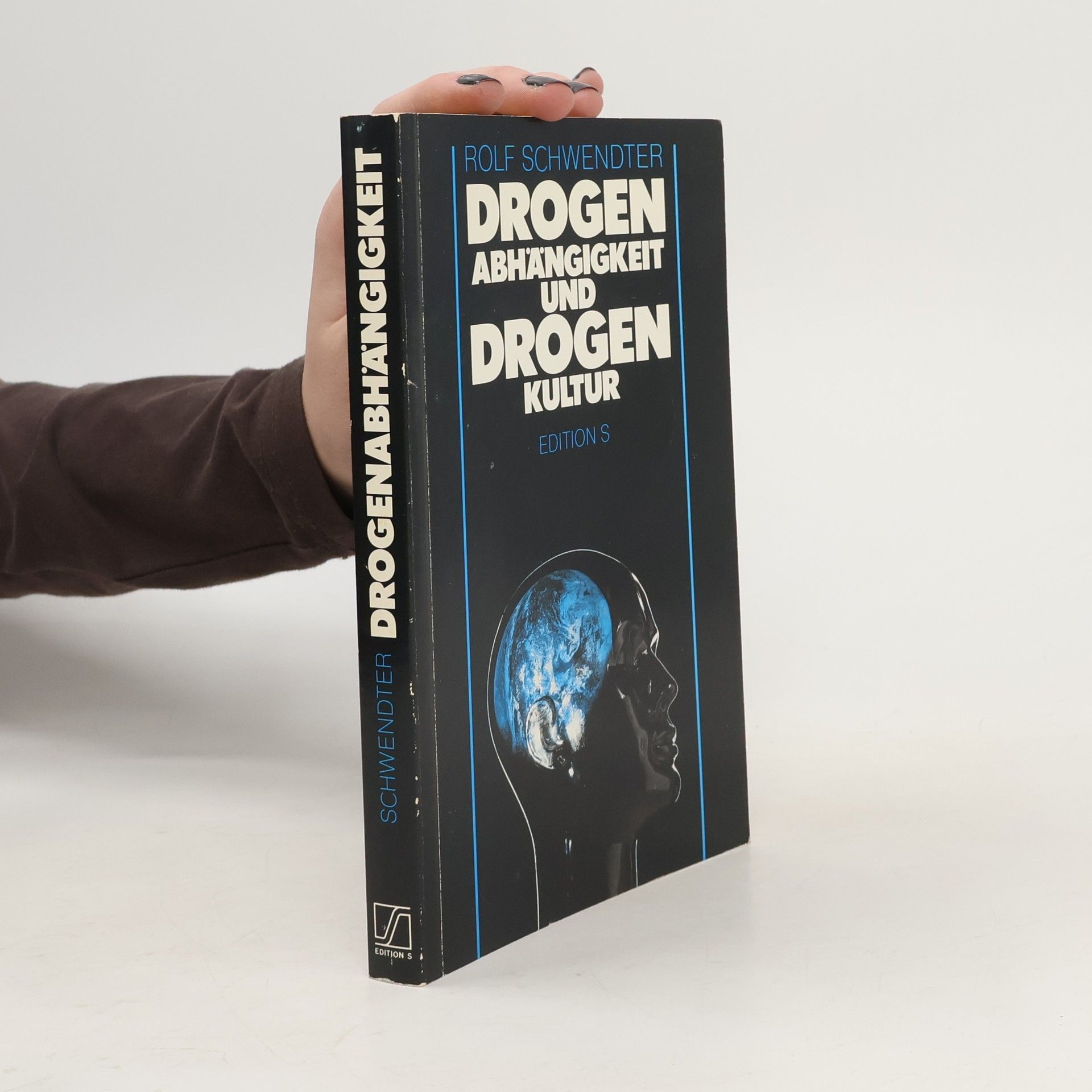


Vergessene Wiener Küche
Kochen gegen den Zeitgeist
Grundlage des Buches bildet jenes Kochbuch der Katharina Prato, das als Standardwerk des 19. Jahrhunderts anzusehen ist. ”Die Prato” bildet auch die Folie jener Halbwertszeit des Vergessens, auf der Standardwerke des 20. Jahrhunderts, wie die Kochbücher von Franz Ruhm oder Plachutta/Wagner skizziert werden können. Die Küche der reichen Leute betreffend, erscheint es bis heute als Rätsel, wieso z. B. die Oglio-Suppe (auch Olla oder Oliosuppe), die Krönung der Wiener Hofbälle des 19. Jahrhunderts, so umstandslos vergessen hatte werden können. Die Küche der armen Leute ist gleichermassen vor dem Verschwinden nicht gefeit. Wo findet sich noch ein Semmelkoch, eine Brottorte, ein Kuttelragout, eine Panadelsuppe. ?
Der Grüne Zweig - 179: Ein lüderliches Leben
Portrait eines Unangepassten: Festschrift für Ernest Borneman zum achtzigsten Geburtstag
- 427bladzijden
- 15 uur lezen
Libro usado en buenas condiciones, por su antiguedad podria contener señales normales de uso
Almanach für Literatur und Theologie - 5: Tod in der Gesellschaft
- 208bladzijden
- 8 uur lezen
Zukunftsforschung und Sozialismus - 1: Zur Geschichte der Zukunft
Zukunftsforschung und Sozialismus
German



