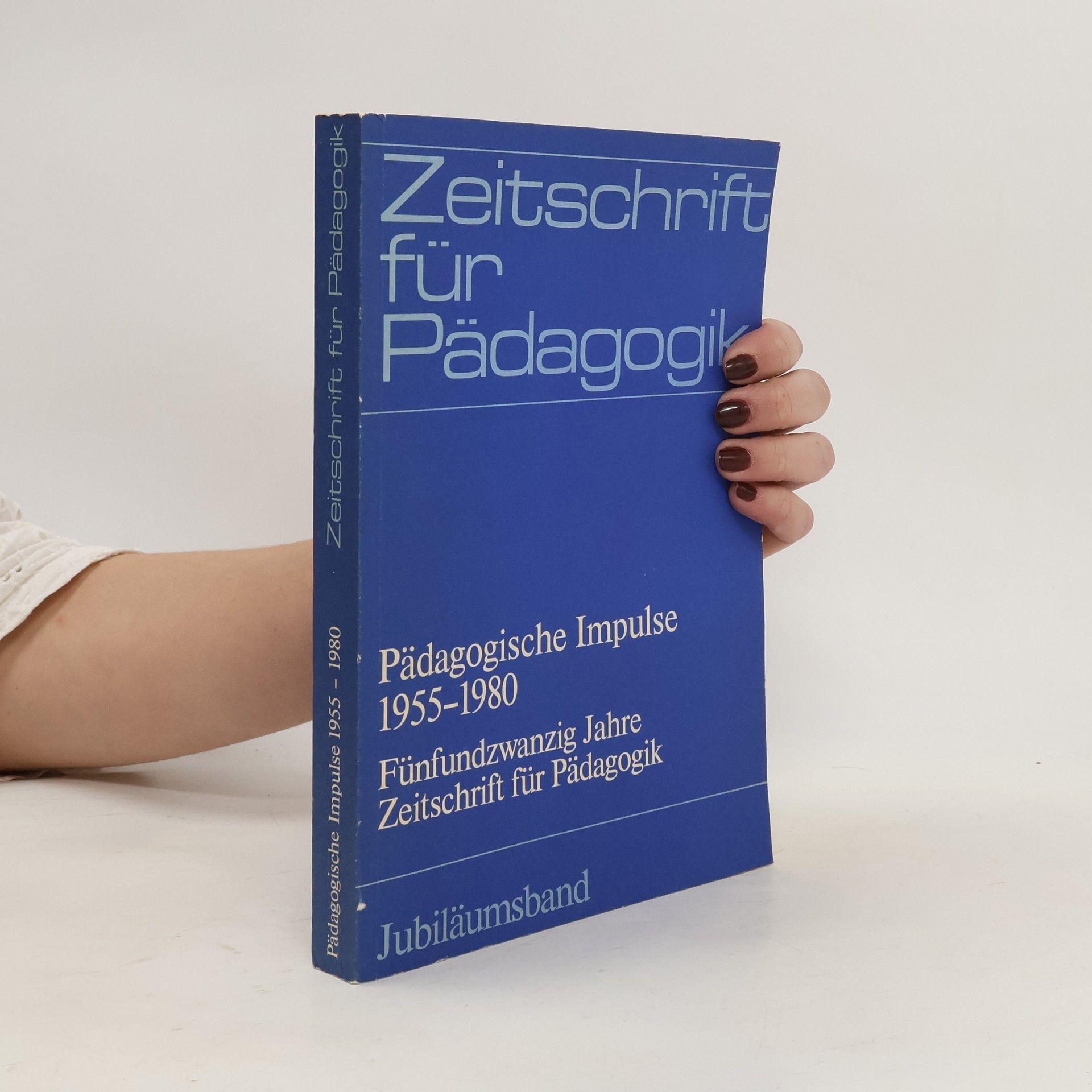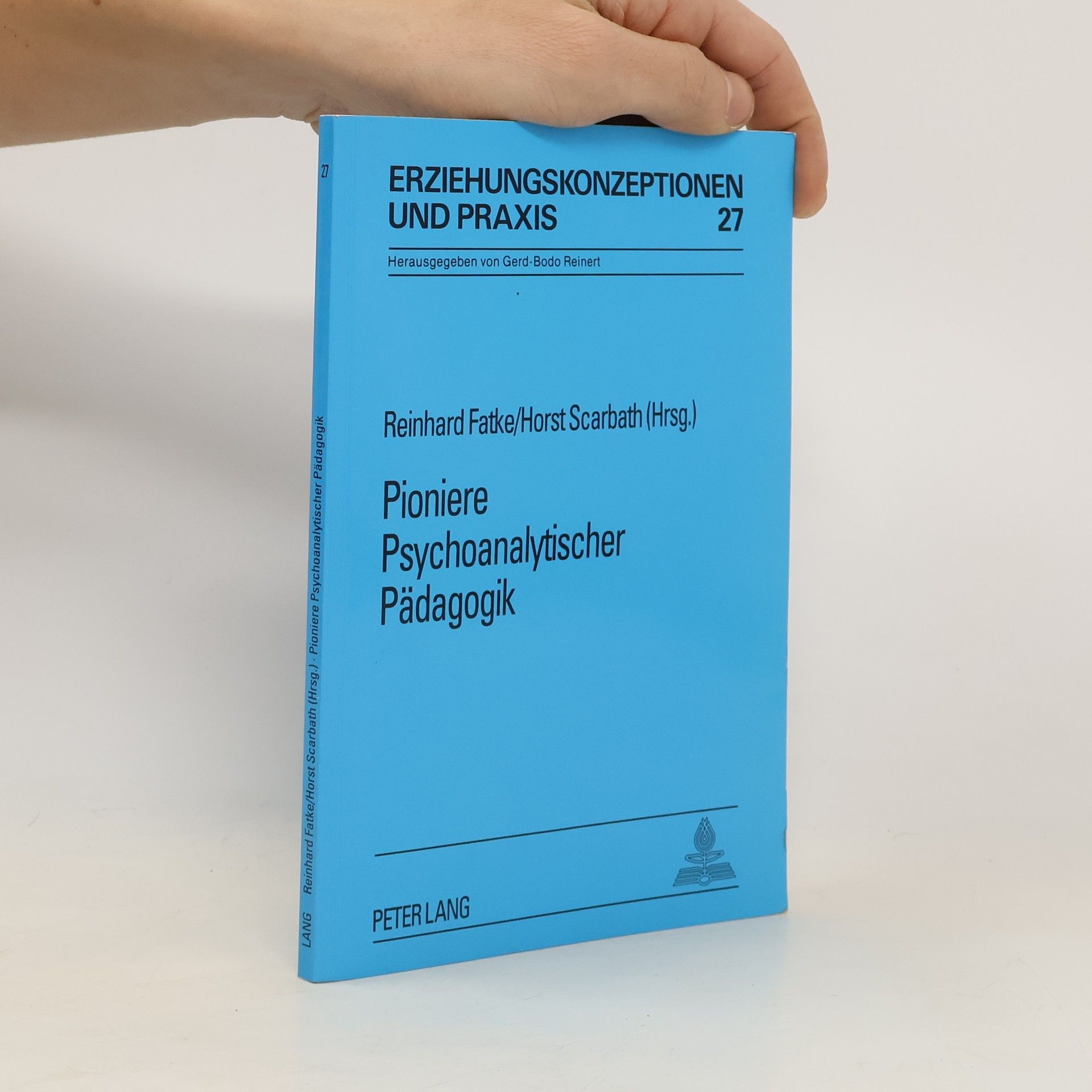Die Psychoanalytische Pädagogik ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden, als sich Psychoanalytiker und Pädagogen (Lehrer, Fürsorgeerzieher u. a.) zusammenfanden, um das Erziehungswesen zu verbessern und vor allem Kindern und Jugendlichen, die emotionale Probleme haben und sozial auffällig sind, mit neuen Konzepten und Handlungsformen zu helfen. Der Lebensweg und das Wirken der wichtigsten Wegbereiter eines neuen pädagogischen Denkens und Handelns werden vorgestellt, und ihre bleibende Leistung für eine Erziehung auf psychoanalytischer Grundlage, die auch und gerade heute wieder von großer Aktualität ist, wird herausgearbeitet. Autoren der Beiträge sind namhafte Erziehungswissenschaftler und Psychoanalytiker.
Reinhard Fatke Boeken