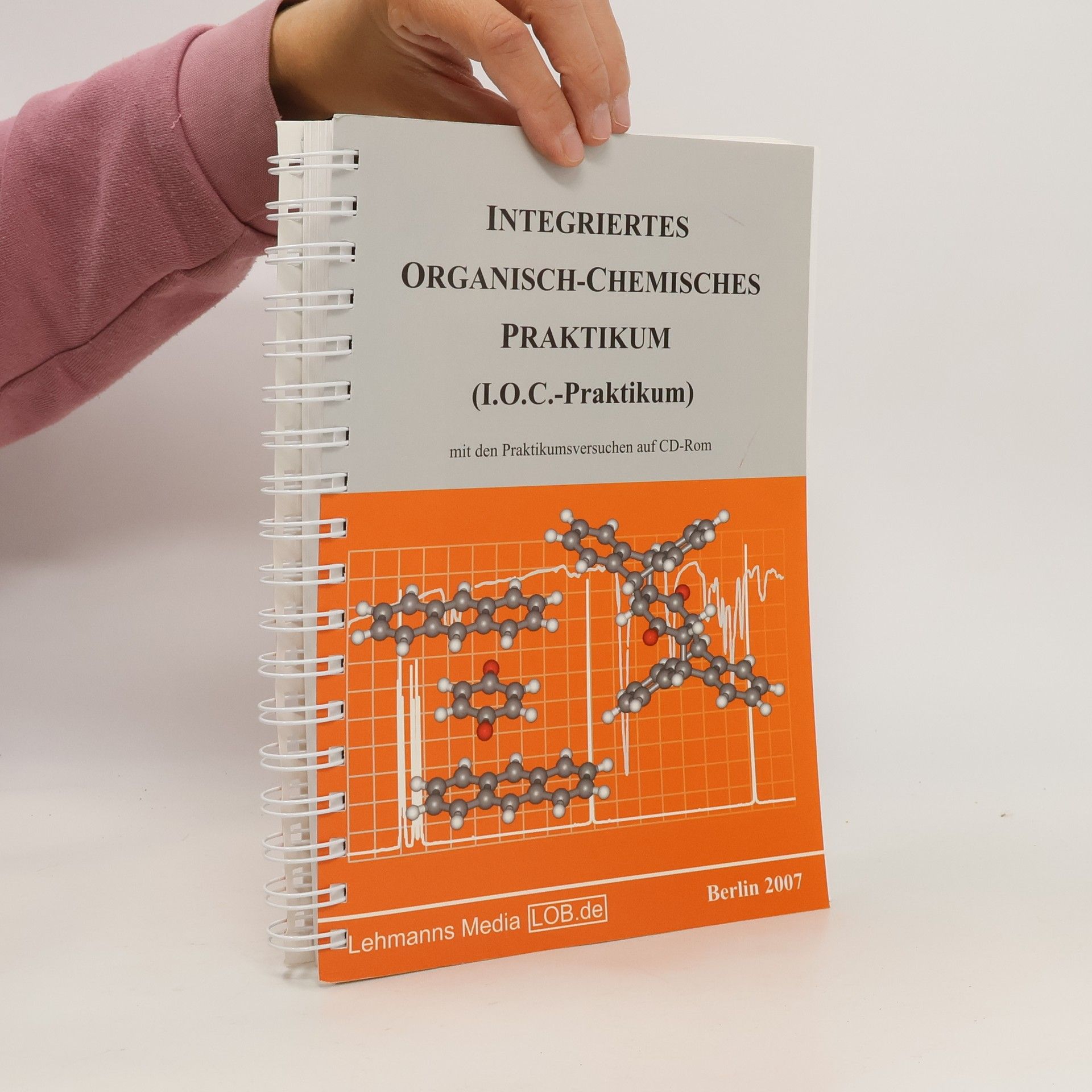Das vorgestellte Praktikum basiert auf der Arbeit von S. Hünig, G. Märkl und J. Sauer aus dem Jahr 1979 und ist nicht als klassisches Kochbuch konzipiert. Es integriert alle Aspekte, die bei Experimenten in wissenschaftlichem Neuland berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören Spektroskopie, die Diskussion relevanter Spektren in Bezug auf mögliche Reaktionsprodukte, die theoretische Analyse der Reaktionsabläufe und die Formulierung der Reaktionsmechanismen. Das Praktikum ist nach Reaktionstypen gegliedert, wobei die Versuche in den Unterkapiteln, wo möglich, miteinander vernetzt sind, um forschungsnahe Bedingungen zu simulieren. Der Text enthält allgemeine Kapitel zu Sicherheit und Standard-Reaktionsapparaturen sowie eine Übersicht der 154 Versuche in 7 Kapiteln mit 24 Unterkapiteln, ergänzt durch Formelbilder. Die theoretischen Übersichten und Einführungen zu den Unterkapiteln bilden das Kernstück und bieten einen Überblick über die organische Chemie. Zudem sind umfangreiche Literatursammlungen enthalten, die über die Voraussetzungen für ein erstes organisches Praktikum hinausgehen. In den letzten Jahrzehnten haben Umwelt- und Sicherheitsaspekte an Bedeutung gewonnen, was zu einem Austausch problematischer Chemikalien gegen umweltfreundlichere Alternativen führte. Die Anzahl der eingesetzten, nicht toxischen Lösungsmittel wurde reduziert, und deren Wiederverwendbarkeit durch Redestillation sichergestellt. Die Reaktionsapparatu
Siegfried Hünig Boeken