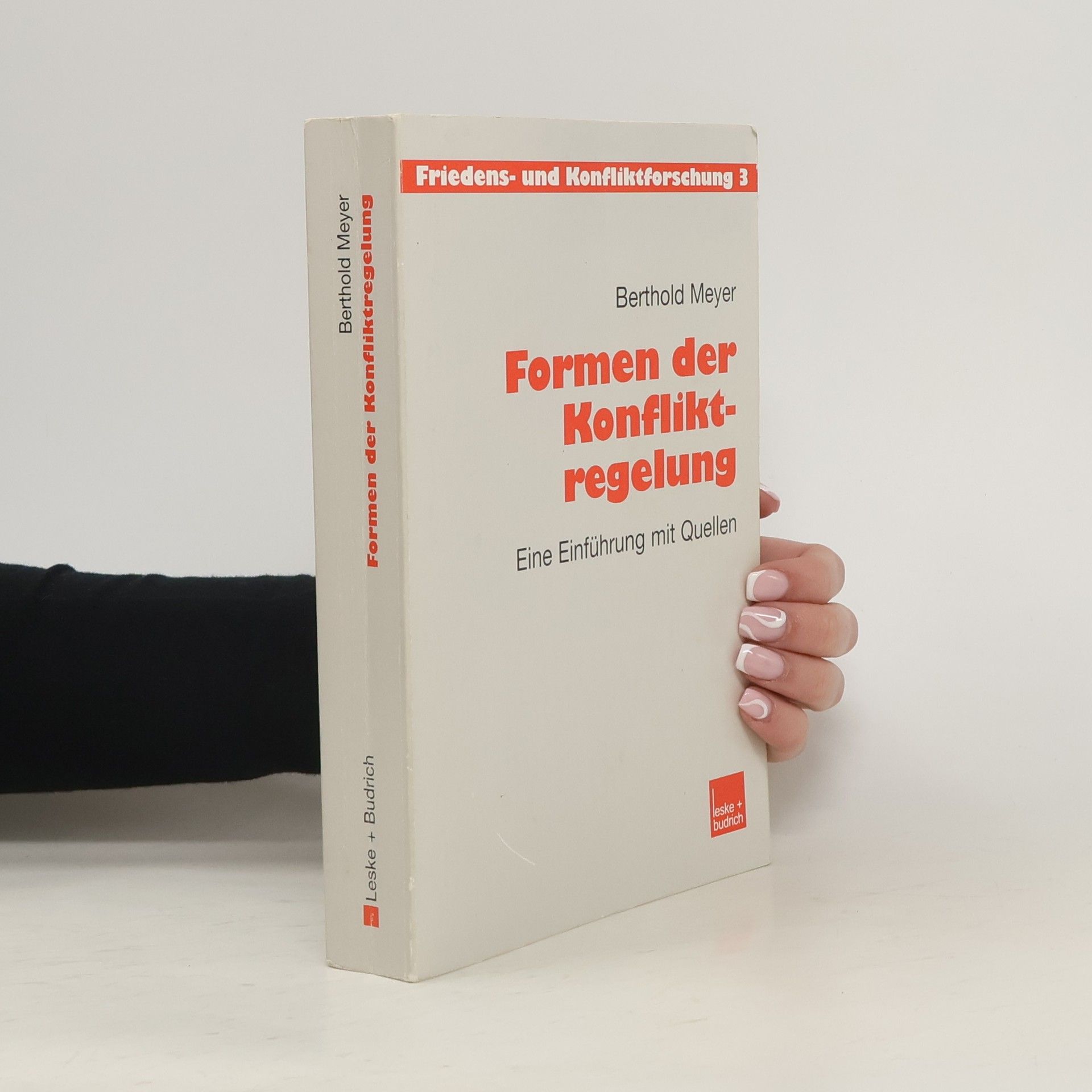Inhaltsverzeichnis1. Grundfragen: Entstehung und Austragungsformen von Konflikten, Hindernisse bei ihrer Regelung und Strategien, diese zu überwinden.- 1. Bedingungen der Entstehung von Konflikten.- 2. Probleme des ungeregelten Konfliktverlaufs.- 3. Konfliktbearbeitung: Konfliktlösung oder Suche nach einem modus vivendi?.- 4. Inhaltliche Differenzierung: Interessen-, Wert- und Machtkonflikte.- 5. Die Bedeutung von Kommunikations- und Beziehungsstörungen sowie (weiteren) psychologischen Hindernissen.- 6. Strukturelle Probleme.- 7. Zur Auswahl der Quellentexte zu diesem Kapitel.- 8. Literatur.- Quellentexte.- 2. Beispiele zur Konfliktregelung im gesellschaftlichen Bereich.- Einführung.- 2.1 Recht und Gesetze als Konfliktregelungsinstrumente.- Quellentexte.- 2.2 Konfliktverlagerung: vom “Bündnis für Arbeit” zum Streit um die Lohnfortzahlung.- 2.3 Konfliktverwaltung am Beispiel der Auseinandersetzung um die Beibehaltung der Allgemeinen Wehrpflicht.- 3. Fallstudien zur Konfliktregelung im interethnischen Bereich.- Einführung.- Quellentexte.- 4. Fallstudien zur institutionellen Konfliktregelung im internationalen Bereich.- Einführung.- 4.1 Von der KSZE zur OSZE: vom “Kleinarbeiten” des einen großen Konfliktes zur simultanen “Konfliktverhütung” an zahlreichen kleineren Herden.- Quellentexte.- 5. Ausblick: Zivilisierung als Weg und Ziel der Konflikttransformation?.
Berthold Meyer Boeken