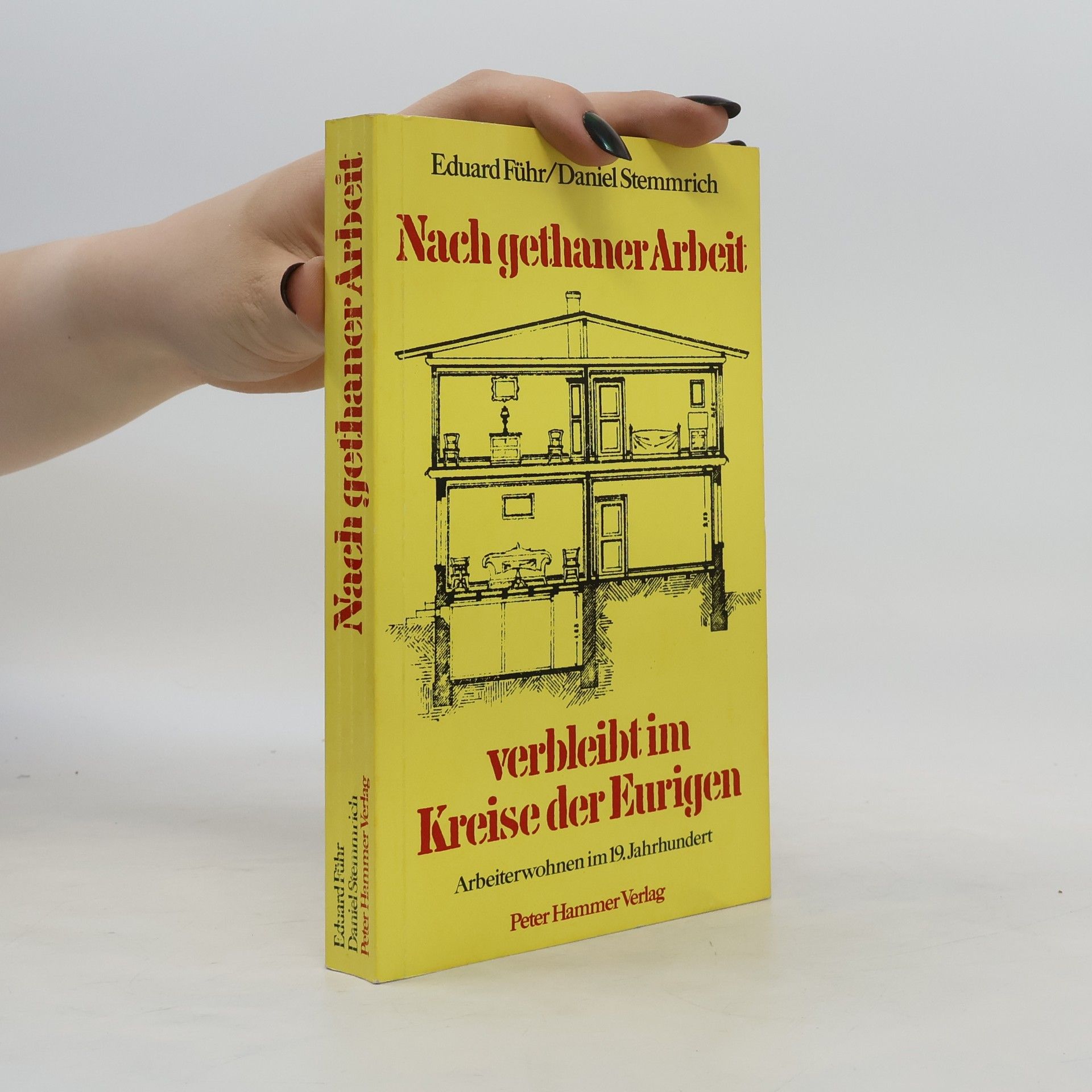Der Architekt Cäsar Pinnau (1906-1988) ist bis heute heftig umstritten: War er ein wichtiger Vertreter nationalsozialistischer Architektur? Hat sich seine Haltung in sein Wirken nach 1945 übertragen? Oder fühlte er sich zeitlebens dem überhistorischen Klassizismus verpflichtet? Eduard Führ untersucht, wie die Identität eines Architekten entworfen wird - durch selektive Zusammenstellung seiner Werke und durch unscharfe Datierungen, durch Konstruktion einer Biografie und durch Publikationen. Die Studie zeigt, wie Pinnau selbst in seinen Werken für Staat, Unternehmen und Eliten Identitäten gestaltet, und diskutiert, wie die Ansätze einer Analyse Pinnaus zu kontroversen Identitätsbestimmungen der Disziplin Architektur genutzt werden.
Eduard Führ Boeken