Männerweiblichkeit. Zur Homosexualität bei Klaus und Thomas Mann.
- 415bladzijden
- 15 uur lezen

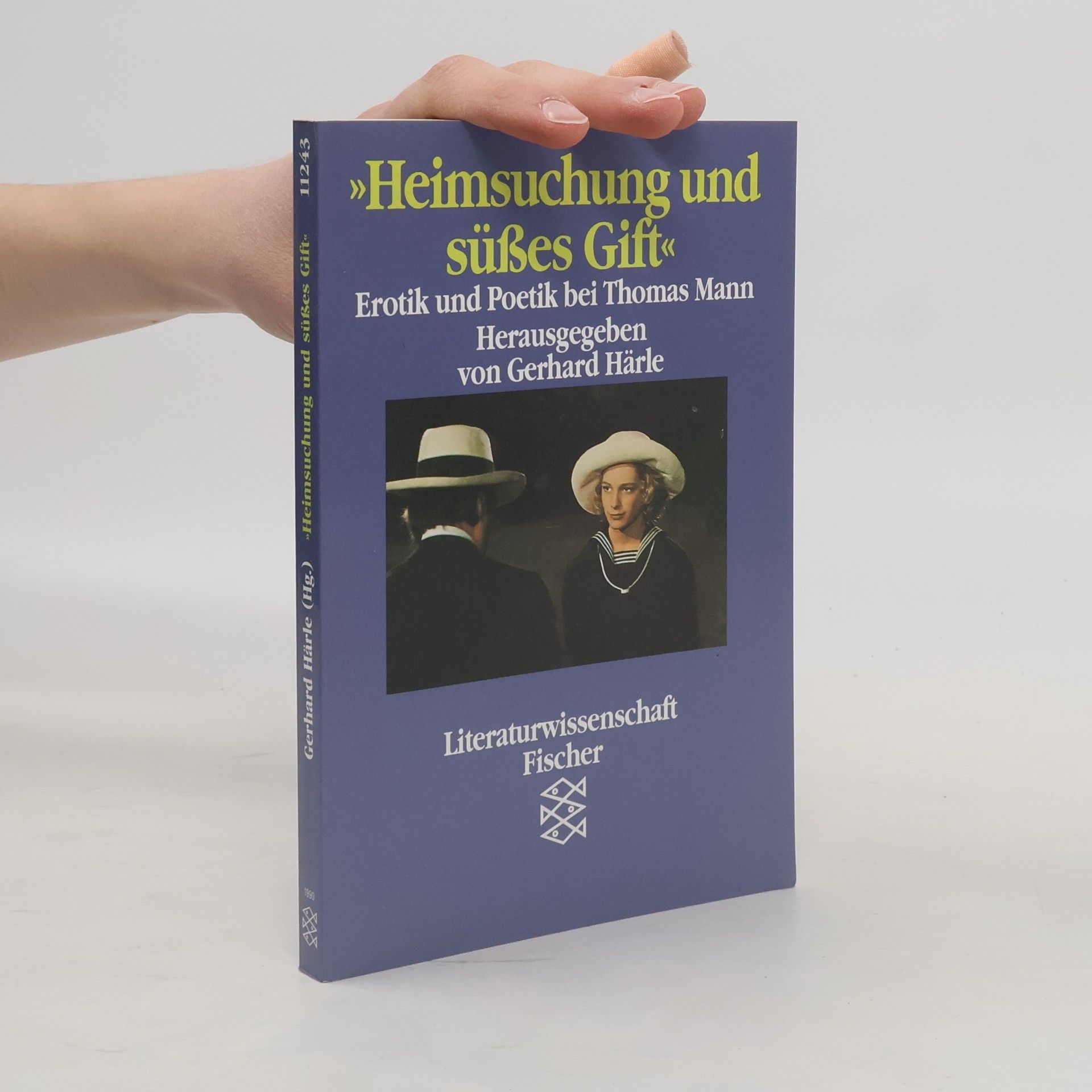


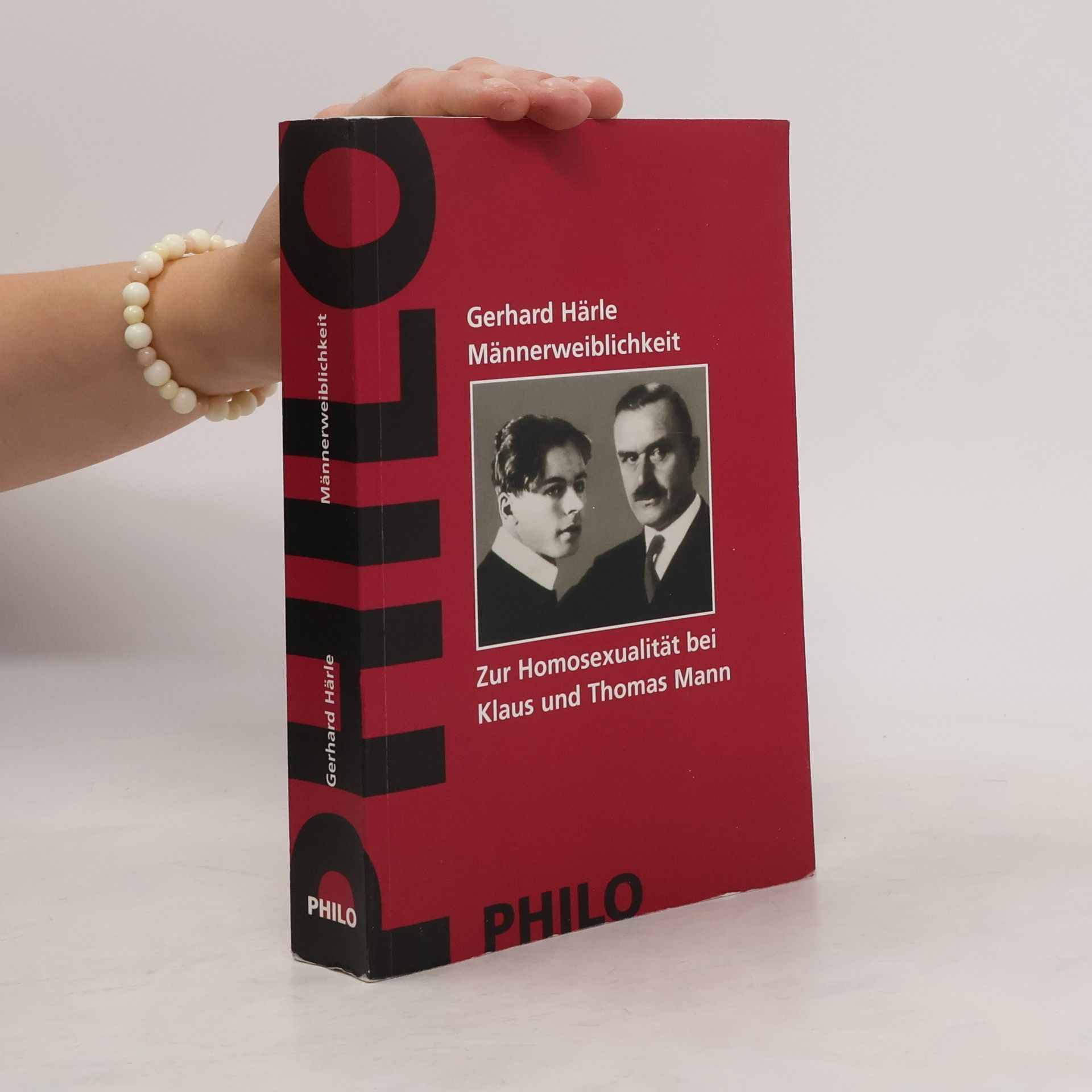
Die Beiträge stammen von renommierten Expertinnen und Experten der Kinder- und Jugendbuchforschung, die im Rahmen eines Studientags zu Ehren von Bernhard Rank an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg am 11. Mai 2004 präsentiert wurden. Sie beleuchten die Rolle des Staunens für die kindliche Rezeption von Literatur, untersuchen Wirklichkeitsmodelle in kinderliterarischen Texten und deren Auswirkungen auf die Literaturdidaktik. Die Hypothese, dass Staunen der Beginn des Nachdenkens ist, wird in den Aufsätzen der ersten Abteilung, die sich mit Staunen als ästhetischer Kategorie befassen, vertieft. Hier wird erörtert, wie ästhetische Dimensionen kinderliterarischer Texte für Lektüre und Unterricht erschlossen werden können, einschließlich verschiedener didaktischer Ansätze. Die zweite Abteilung behandelt die Konfrontation erzählter und realer Welten und thematisiert die Herausforderungen, die sich aus dieser Beziehung ergeben. Abgeschlossen wird der Band mit vier programmatischen Aufsätzen zu Grundfragen der literarischen Bildung, die zukunftsweisende Perspektiven für die Auffassung von literarischer und Medienkompetenz bieten. Ein besonderes Highlight sind sechs Originaltexte des Schweizer Kinder- und Jugendbuchautors Jürg Schubiger, die hier erstmals veröffentlicht werden.