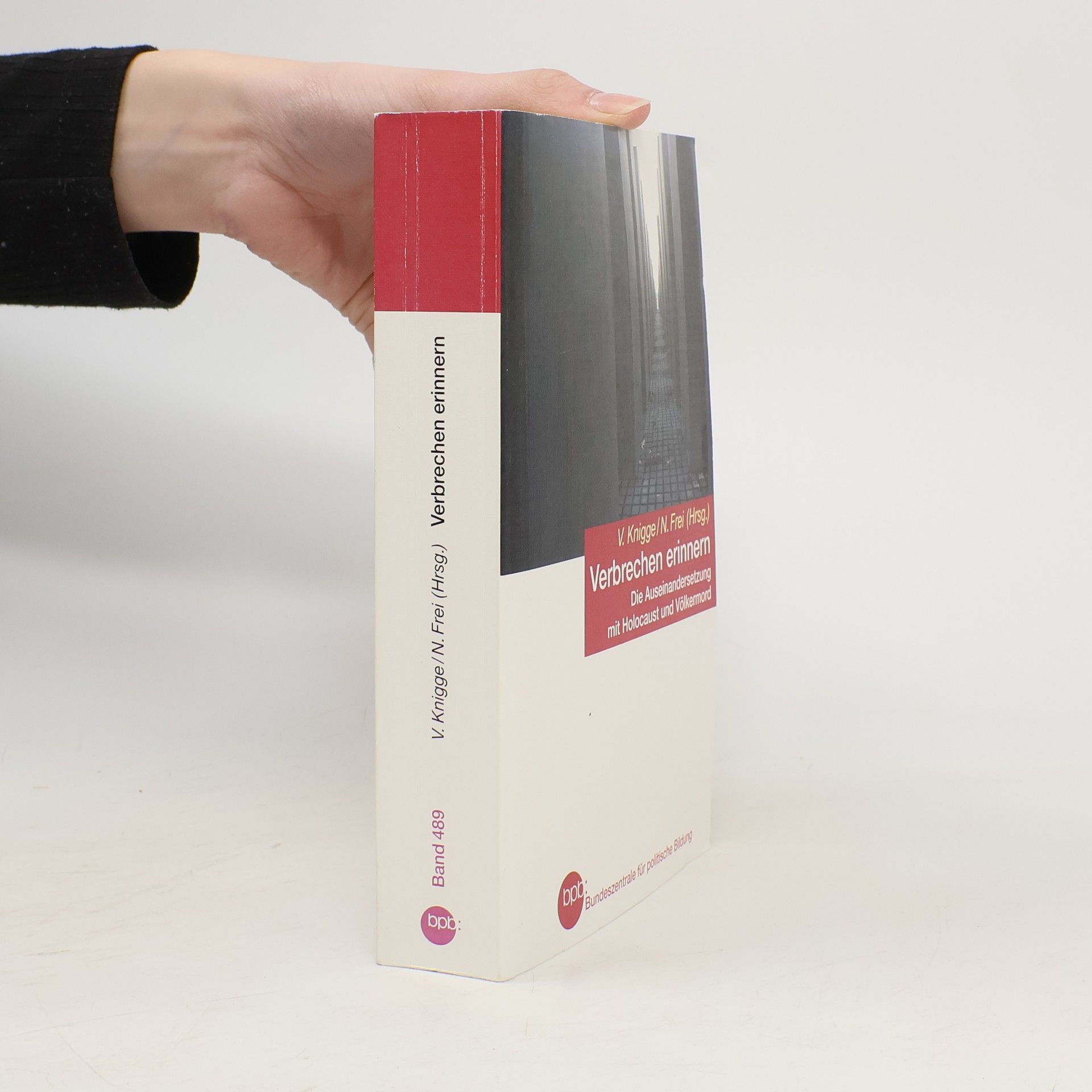Abschied von der Erinnerung
Zur Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust
- 200bladzijden
- 7 uur lezen
Die extreme Rechte gewinnt in Deutschland stetig an Zustimmung. Die AfD hat sich in den Parlamenten fest etabliert; sie relativiert den Nationalsozialismus, verschiebt die Grenzen des Sagbaren und schreibt Geschichte um. Auch wenn Deutschland als durch die Erinnerung an den Nationalsozialismus geläutertes Land gilt, hat die Erosion der sogenannten Erinnerungskultur längst begonnen. Moralisch aufgeladene Floskeln verdrängen historisches Wissen und Urteilsfähigkeit. Erinnern löst sich von kritischem Geschichtsbewusstsein, dient imaginären Identitätskonstruktionen und befördert Erinnerungskämpfe. Vor diesem Hintergrund bedeutet Abschied von der Erinnerung vor allem, sich von Läuterungsgewissheit und Selbstzufriedenheit zu verabschieden und sich den Fallstricken des Erinnerns bewusst zu werden. Dieses Buch ist ein Einspruch gegen ein Erinnern, das historisches Begreifen zugunsten entlastender Identifikation mit »den« Opfern und kollektiver Identität in den Hintergrund drängt. Historisches Erinnern sollte, so das Plädoyer Volkhard Knigges, an ein kritisches Geschichtsbewusstsein und wirksame Gesellschaftskritik gekoppelt sein. Er spricht in diesem Essay nicht nur als Historiker, hat er doch die konkrete Arbeit von KZ-Gedenkstätten in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer.