Siegfried Blasche Boeken

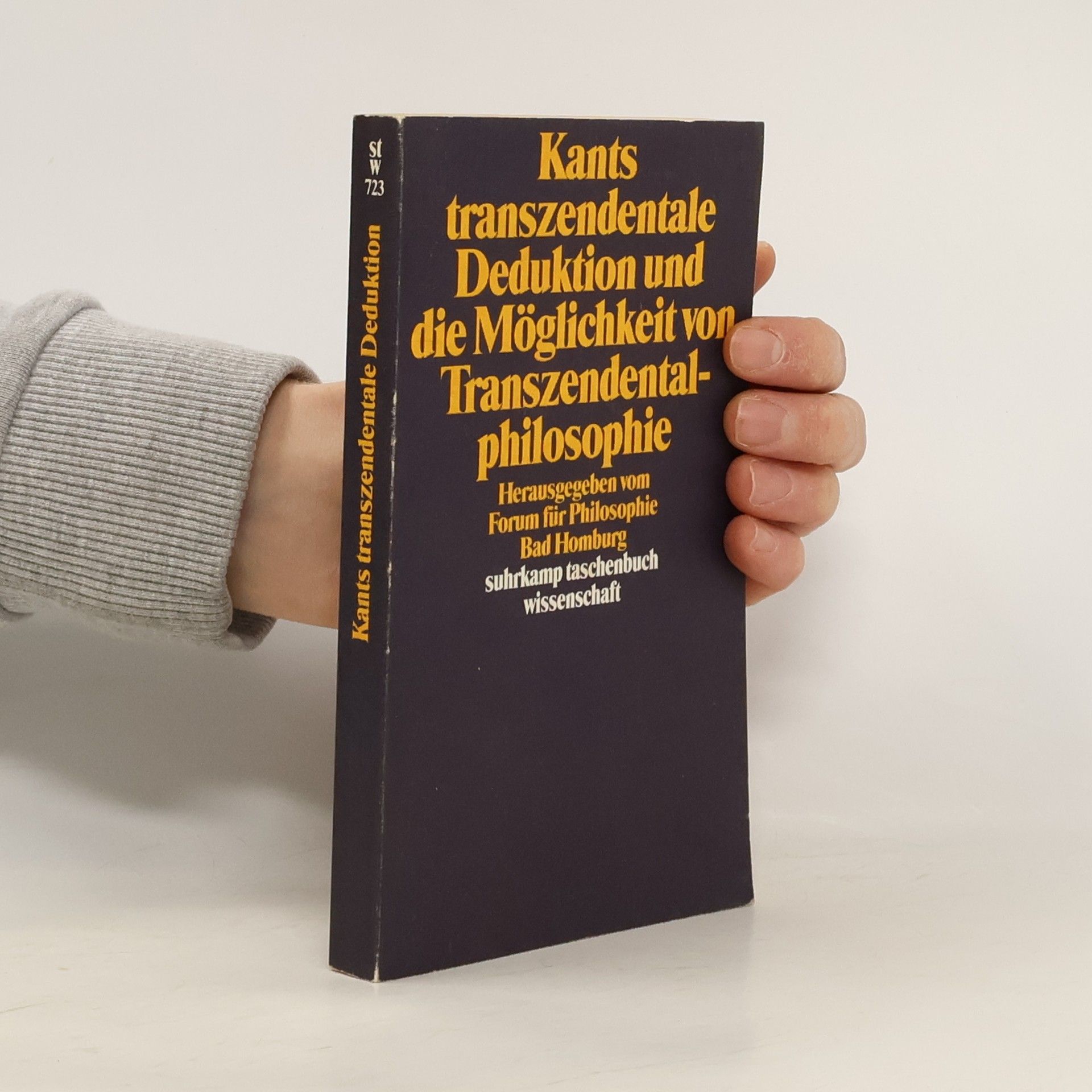
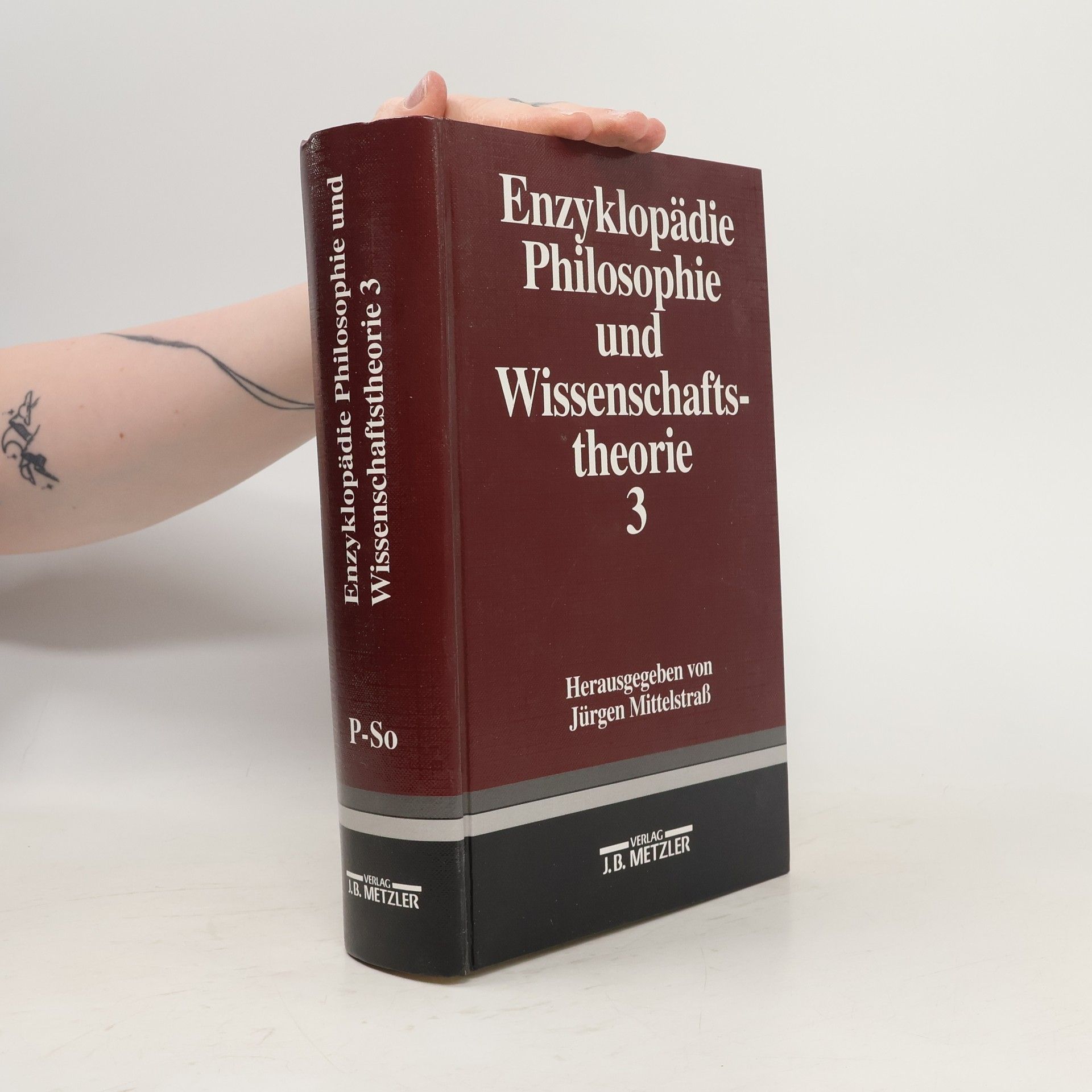

Herausgegeben vom Forum für Philosophie, Bad HomburgMan bemüht sich, Kants schwierige Gedankengänge mit den inzwischen gewonnenen begrifflichen Mitteln zu entwirren und ihnen eine überprüfbare Ordnung zu geben, um die dunkle transzendentalphilosophische Denkart gleichsam zu lichten und begrifflich zu domestizieren. Dabei erweist sich für manchen eine mehr oder minder eingreifende »Kant-Transformation« (Apel) als unumgänglich. Kant-Interpretation, Kant-Rekonstruktion und systematisches Denken gehen dabei Hand in Hand. Über den Umfang des Interesses an Kantischer Transzendentalphilosophie informiert die diesem Band beigegebene Bibliographie. (source: publisher)Inhalt:Seebohm, Thomas M.: Über die unmögliche Möglichkeit, andere Kategorien zu denken als die unseren. Harrison, Ross: Wie man dem transzendentalen Ich einen Sinn verleiht. Übersetzt von Wolfgang R.Köhler. Aschenberg, Reinhold: Einiges über Selbstbewußtsein als Prinzip der Transzendentalphilosophie. Becker, Wolfgang: Über den Objektivitätsanspruch empirischer Urteile und seine transzendentale Begründung. Blasche, Siegfried: Selbstaffektion und Schematismus. Kants transzendentale Deduktion als Lösung eines apriorischen Universalienproblems. Hoppe, Hansgeorg: Die Bedeutung der Empirie für transzendentale Deduktionen. Rohs, Peter: Die transzendentale Deduktion als Lösung von Invarianzproblemen. Kuhlmann, Wolfgang: Kant und die Transzendentalpragmatik. Transzendentale Deduktion und reflexive Letztbegründung. Köhler, Wolfgang R.: Reflexive, transzendentale und skeptische Argumente - ein szenischer Kommentar. Øfsti, Audun: Strawsons Paralogismus. Kants »Ich denke und die Kant-Rekonstruktion Strawsons im Lichte der »Doppelstruktur der Rede. Hossenfelder, Malte: Überlegungen zu einer transzendentalen Deduktion des kategorischen Imperativs. Wüstehube, Axel: Bibliographie. Neuere Literatur zur theoretischen Philosophie Kants (1976-1986).
Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft - 779: Martin Heidegger
Innen- und Außenansichten: Herausgegeben vom Forum für Philosophie Bad Homburg
- 341bladzijden
- 12 uur lezen