Nora Eckert Boeken
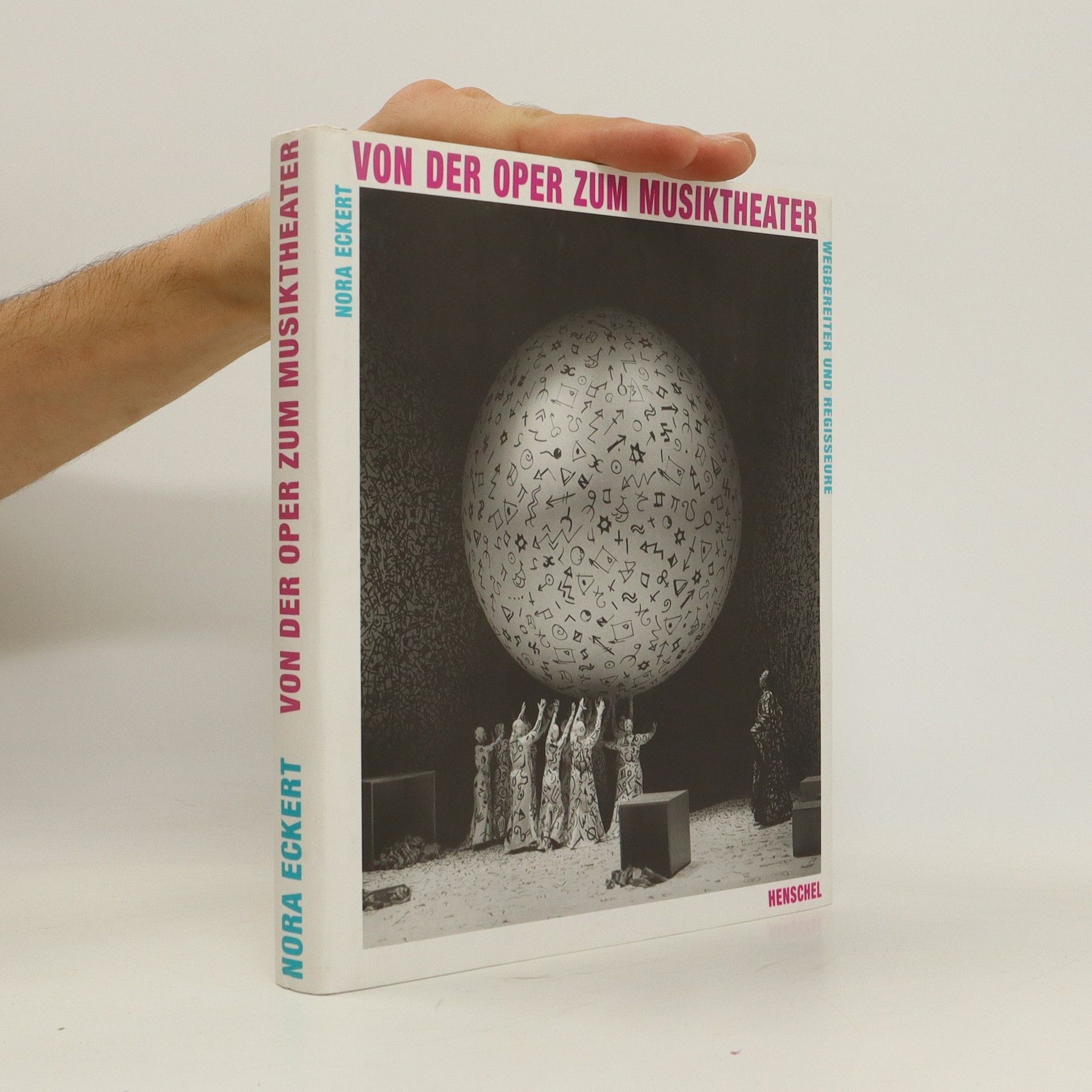


Außerhalb oder innerhalb der Binarität?
Sind wir unsere Genitalien?
Schließt Binarität geschlechtliche Vielfalt aus? Die Autorin sagt nein und begründet, warum das so ist. Sie hinterfragt das bipolare Konzept, das eng mit dem Begriff „biologisches Geschlecht“ verbunden ist, denn damit werden Menschen in der Tat auf Genitalien und Körperfunktionen reduziert. Doch die menschliche Natur sieht nicht zuletzt mit Blick auf trans* anders aus. Binarität und Vielfalt gehören zusammen oder anders gesagt: Natur erlaubt, Kultur verbietet.