Mit Beitr. von Stefan Mächler, Daniel Ganzfried, Hans Stoffels, Eva Lezzi und Eva Liebs über Wilkomirski alias Bruno Grosjean
Irene Diekmann Boeken
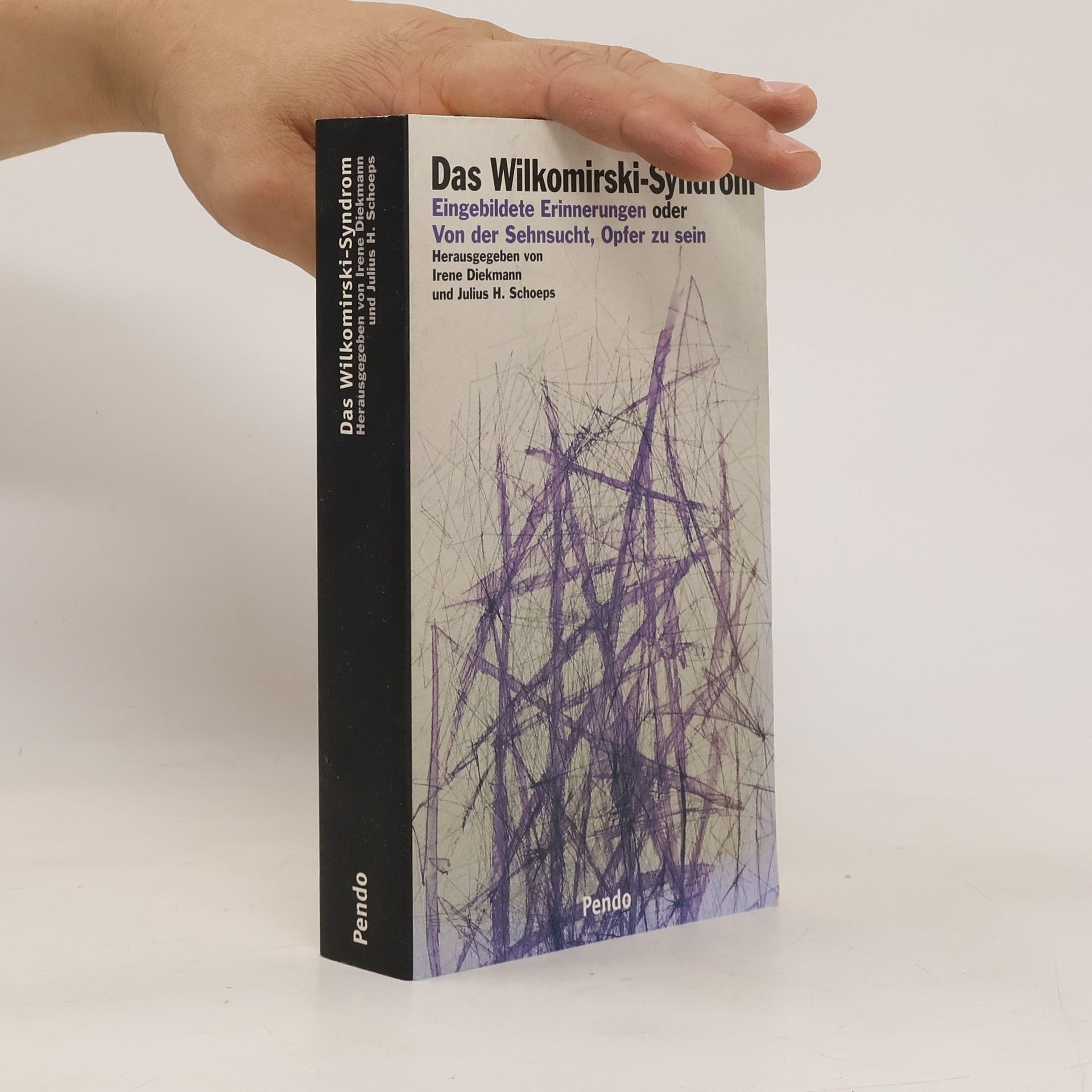
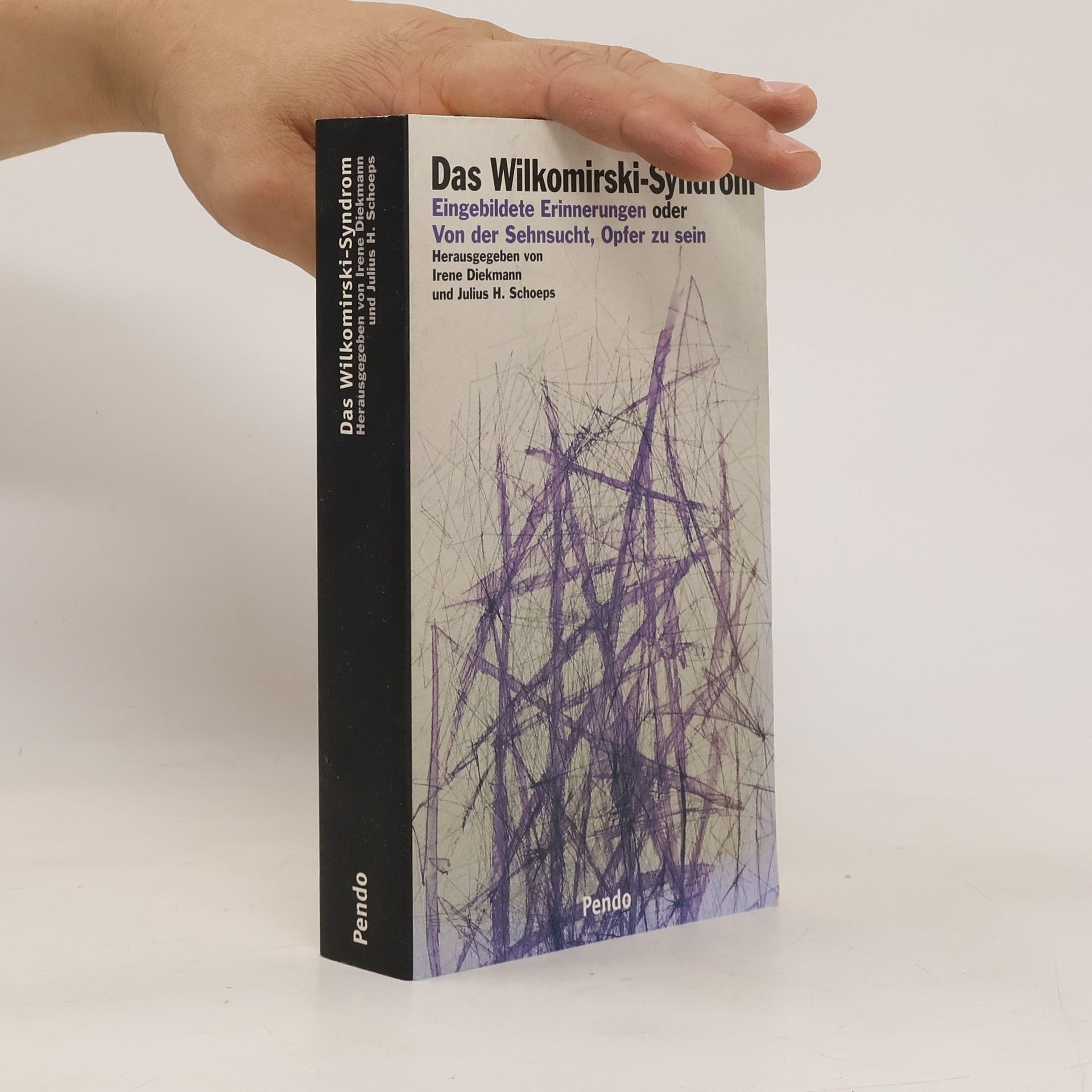
Mit Beitr. von Stefan Mächler, Daniel Ganzfried, Hans Stoffels, Eva Lezzi und Eva Liebs über Wilkomirski alias Bruno Grosjean