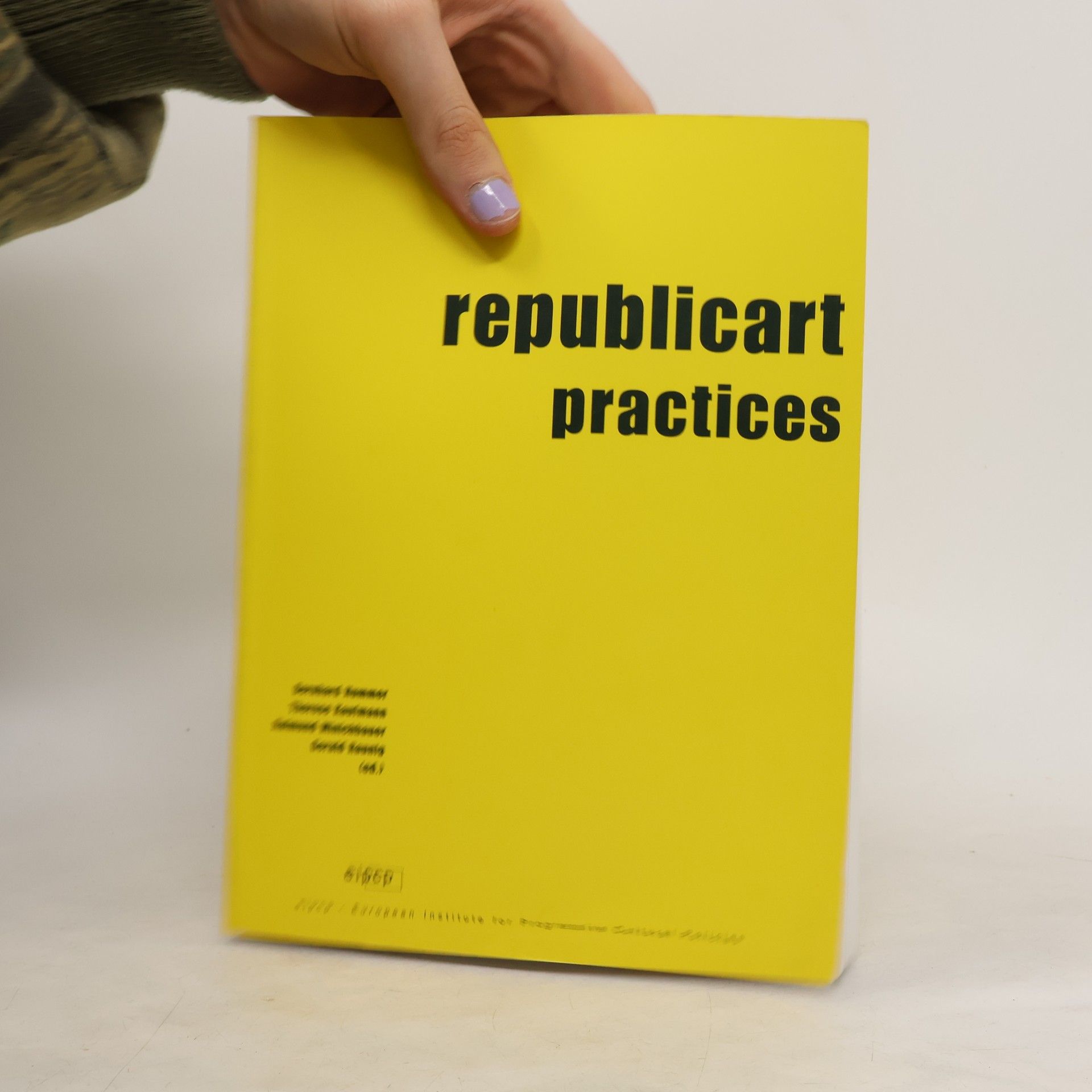Gerald Faschingeder Boeken
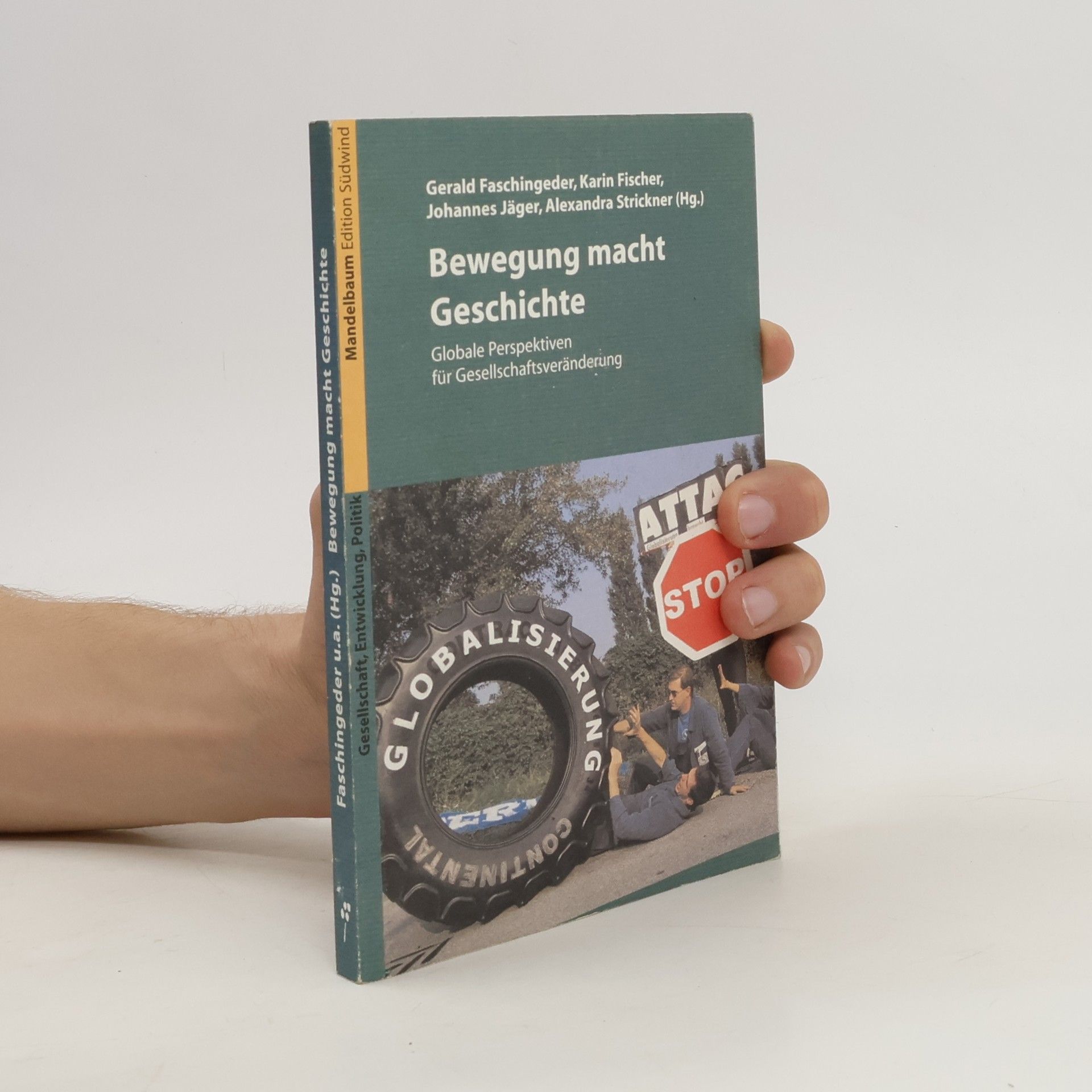
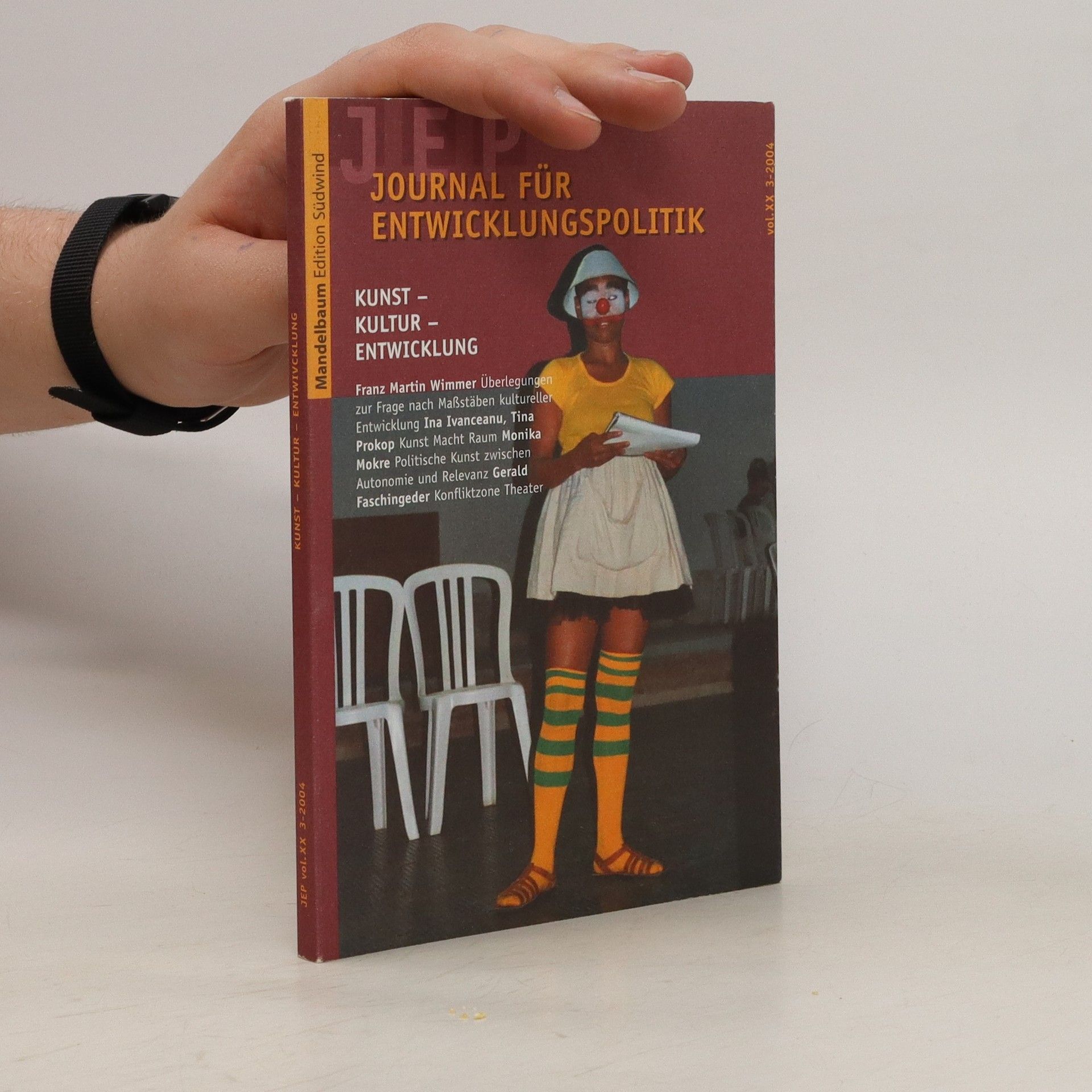

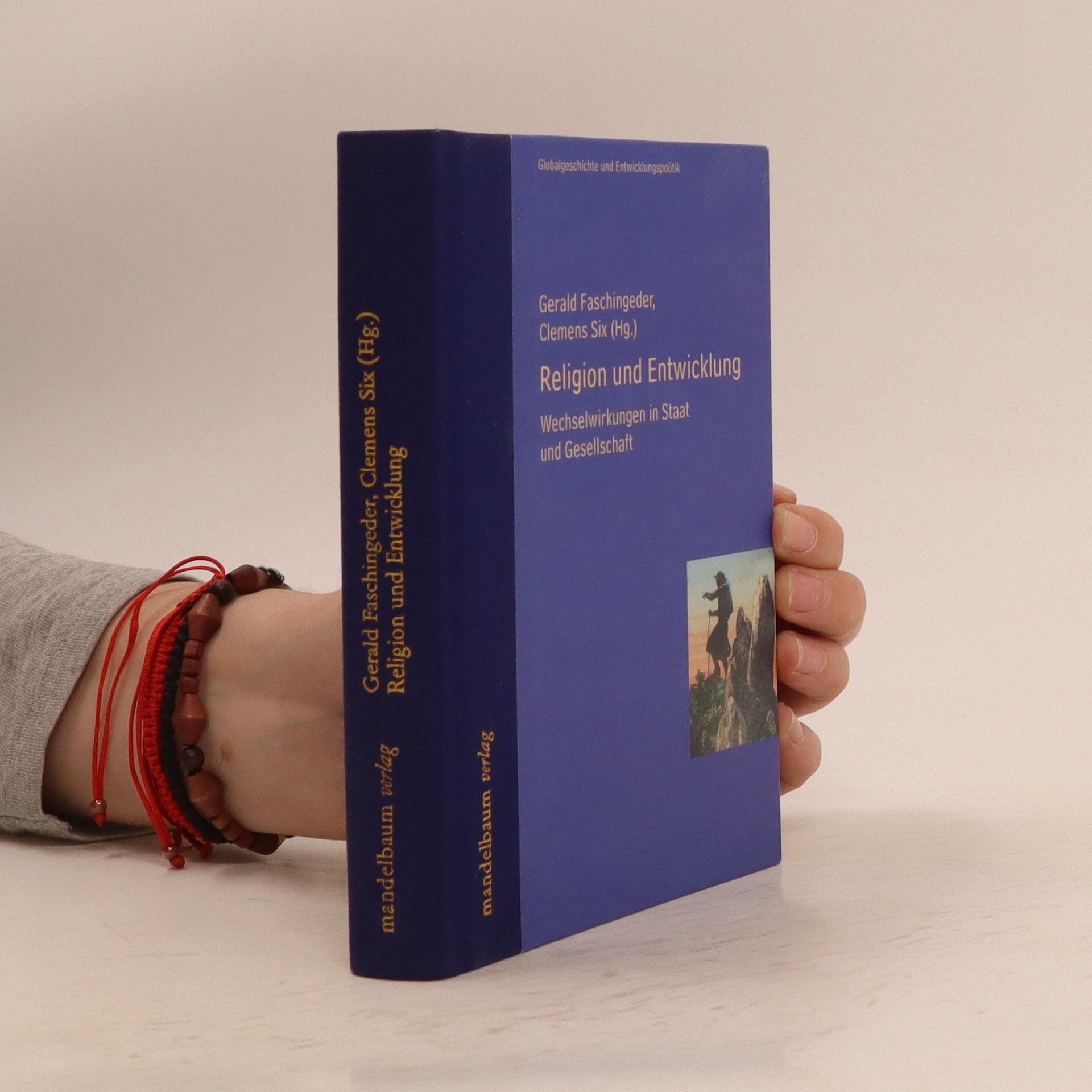

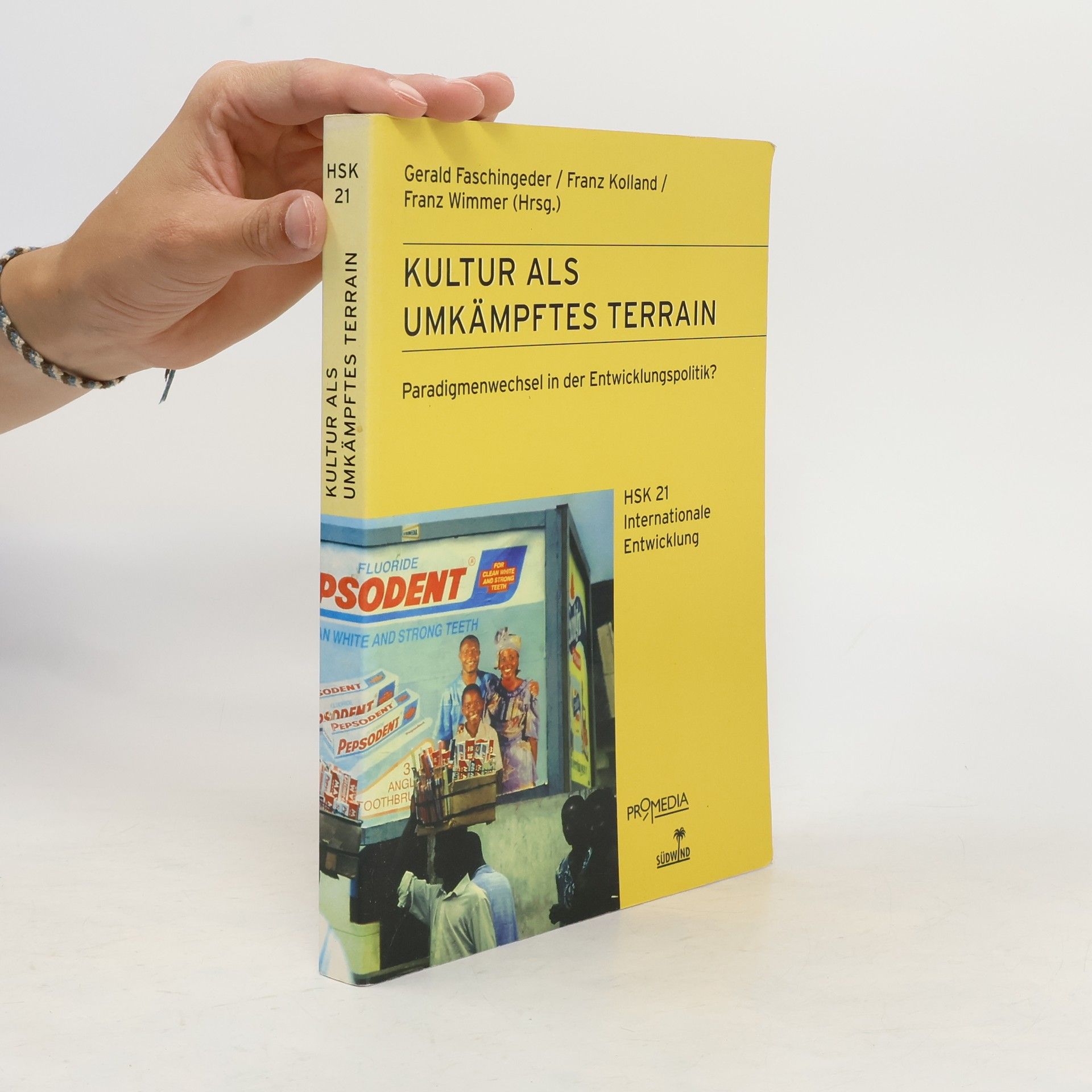
Religion und Entwicklung
- 280bladzijden
- 10 uur lezen
Die Diskussion über Kultur und Entwicklung floriert. Es scheint aber, als verberge sich hinter so mancher Kulturdebatte eigentlich eine Religionsdebatte. Die vorliegende Publikation nähert sich dieser Diskussion in fünf thematischen Bereichen interdisziplinär an. Der einleitende Teil widmet sich den theoretischen Aspekten des Begriffspaares Religion und Entwicklung. Darauffolgend wird die Bedeutung von Religion in der Entwicklungszusammenarbeit thematisiert. Drittens kommt die Rolle von Religion für Entwicklung als sozioökonomische Transformation zur Sprache. Der vierte Teil thematisiert mögliche Zusammenhänge zwischen Religion und nationalstaatlicher Entwicklung. Der abschließende fünfte Teil kreist um das Thema der internationalen Entwicklung.
Bildung nährt das Hoffen auf Befreiung, während sie soziale Ungleichheiten zementiert und sich im Spannungsfeld zwischen Emanzipation und Herrschaft bewegt. In den letzten Jahren zeigt sich, dass Bildung zunehmend auf ökonomische Verwertbarkeit reduziert wird. Die ungebremste Ökonomisierung aller Lebensbereiche führt zu tiefgreifenden Veränderungen in den Gesellschaften des Nordens und Südens. Einsparungen, Umstrukturierungen, Ausgliederungen und Privatisierungen sind die Folgen. Der vorliegende Band analysiert die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf das Bildungswesen und beleuchtet Muster neoliberaler Bildungspolitik sowie mögliche Alternativen. Fragen nach der Gestaltung einer demokratischen Universität und den Merkmalen emanzipatorischer Bildung stehen im Mittelpunkt. Ein neues Verständnis von Bildung und Öffentlichkeit scheint notwendig, um einen kritischen Gegendiskurs zur Ökonomisierung zu entwickeln. Die rasante Ökonomisierung betrifft insbesondere den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und die Machtverhältnisse in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, soziale Dienste und öffentlicher Verkehr. Der Band thematisiert diese Veränderungen und präsentiert Alternativen, um den öffentlichen Charakter der Bildung zu stärken und die Demokratie zu fördern. Themen wie Demokratie versus Ökonomie, soziale Selektion, New Public Management und emanzipatorische Ansätze werden behandelt.
Bewegung macht Geschichte
Globalisierungskritik und Perspektiven für Gesellschaftsveränderung
Die globalisierungskritische Bewegung ist ein faszinierendes Phänomen der letzten Jahre, insbesondere die Proteste gegen das WTO-Treffen in Seattle, die der Nord-Süd-Solidarität internationale Mobilisierungskraft verliehen haben. Parallel dazu setzte das Weltsozialforum 2001 und 2002 in Porto Alegre ein starkes Zeichen, während Sozialforen weltweit und lokal die Diskussion über Alternativen zu aktuellen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodellen förderten. Ziel des vorliegenden Bandes ist es, das gesellschaftliche Veränderungspotenzial dieser neuen sozialen Bewegung zu untersuchen. Kritische Sozialwissenschaften sollen soziale Phänomene analysieren, ohne den eigenen gesellschaftspolitischen Standpunkt zu vernachlässigen, was Norbert Elias als Balance zwischen „Engagement und Distanzierung“ beschreibt. Die Herausgeber/innen und Autor/innen nähern sich ihrem Thema als Teil der Bewegung und streben an, zur wissenschaftlich fundierten Reflexion beizutragen. Neben aktuellen Analysen wird auch der Fokus auf Chancen, Grenzen und mögliche Fallen gelegt, die durch die politökonomische Konjunktur und die Geschichte politischer Bewegungen im Wandel entstehen.