Das Werk erkundet die faszinierende Welt der orientalischen Teppiche und verwandter Textilien wie Taschen und Pferdedecken, während es gleichzeitig die Verbindung zur modernen Kunst herstellt. Ein zentrales Thema sind die Farben und die Färbetechniken, die in der Teppichkunst verwendet werden. Es richtet sich an Liebhaber alter Teppiche, die auch eine Leidenschaft für lebendige Farben und deren Bedeutung in der Kunst haben.
Ulrich Nortmann Boeken
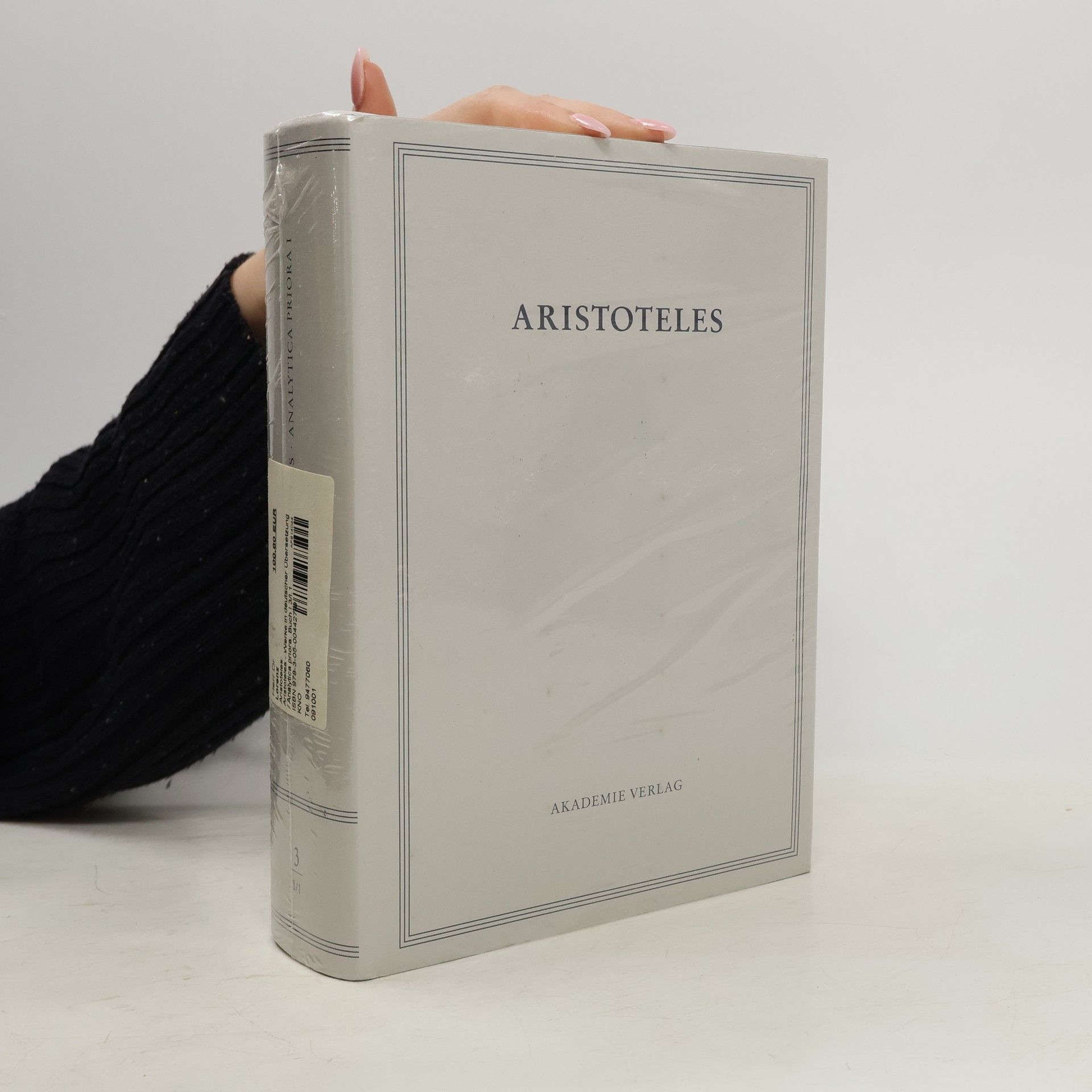

Werke in deutscher Übersetzung - 1: Analytica Priora. Buch I (German Edition)
- 924bladzijden
- 33 uur lezen
Mit den Ersten Analytiken macht Aristoteles erstmalig in der europäischen Wissenschaftsgeschichte das logisch zwingende Argumentieren zum Gegenstand einer systematischen Untersuchung. Dabei gewinnt er im ersten Buch der aus zwei Büchern bestehenden Schrift wichtige Einsichten in die Natur logischer Gültigkeit. Weiter führt er die Idee einer axiomatischen Organisation logischer Theoreme ein, analysiert logisch-semantische Beziehungen zwischen verschiedenen Modalbegriffen sowie Typen von Modalaussagen und beschäftigt sich auch mit heuristischen Aspekten deduktiven Argumentierens. Aristoteles schränkt seine Untersuchung auf Argumentationsweisen in der Form sogenannter Syllogismen ein. Innerhalb dieses aus heutiger Sicht eher eng gezogenen logischen Rahmens gelingt ihm gleichwohl ein Theoriestück von hohem Niveau, das auf die spätere Wissenschaftsentwicklung einen erheblichen Einfluss ausübte. Die Bedeutung, die den Ersten Analytiken zugemessen worden ist, zeigt sich nicht zuletzt in einer zweitausendjährigen, keineswegs auf den abendländischen Raum beschränkten Kommentierungstradition.