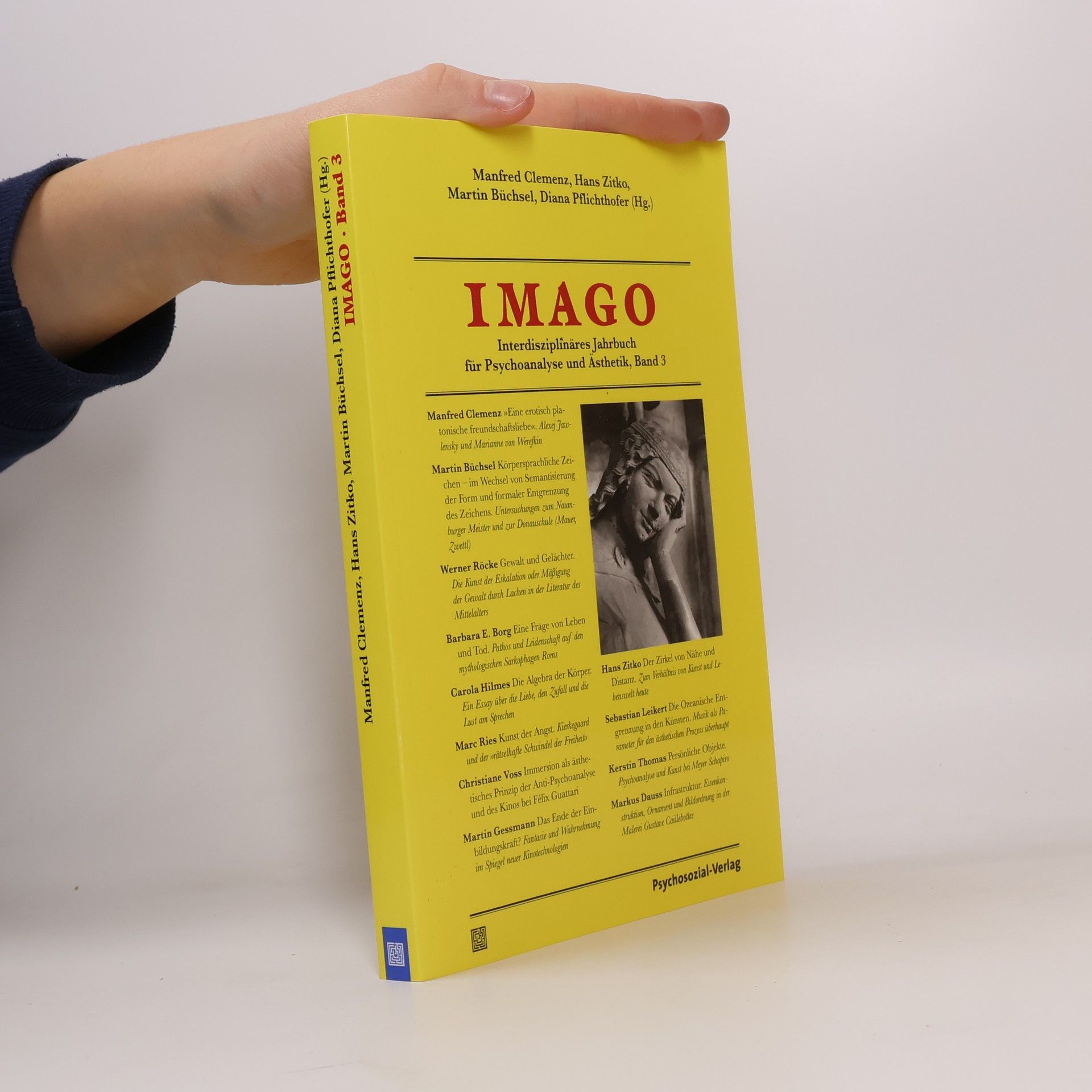Hegel
- 156bladzijden
- 6 uur lezen
§ Georg Wilhelm Friedrich Hegels universales systematisches Denksystem umfasst ein unglaublich breites Spektrum philosophischer Themen, wie Natur, Psyche, Gesellschaft, Politik, Recht, Geschichte, Ästhetik, Religion und Logik. Die prägnante Einführung erläutert verständlich die Grundzüge der Hegelschen Philosophie. Sie verdeutlicht, dass Hegels umfassender Entwurf des menschlichen Geistes, den Schlusspunkt und sogleich den Ausgangspunkt einer großen philosophischen Tradition bildet.§