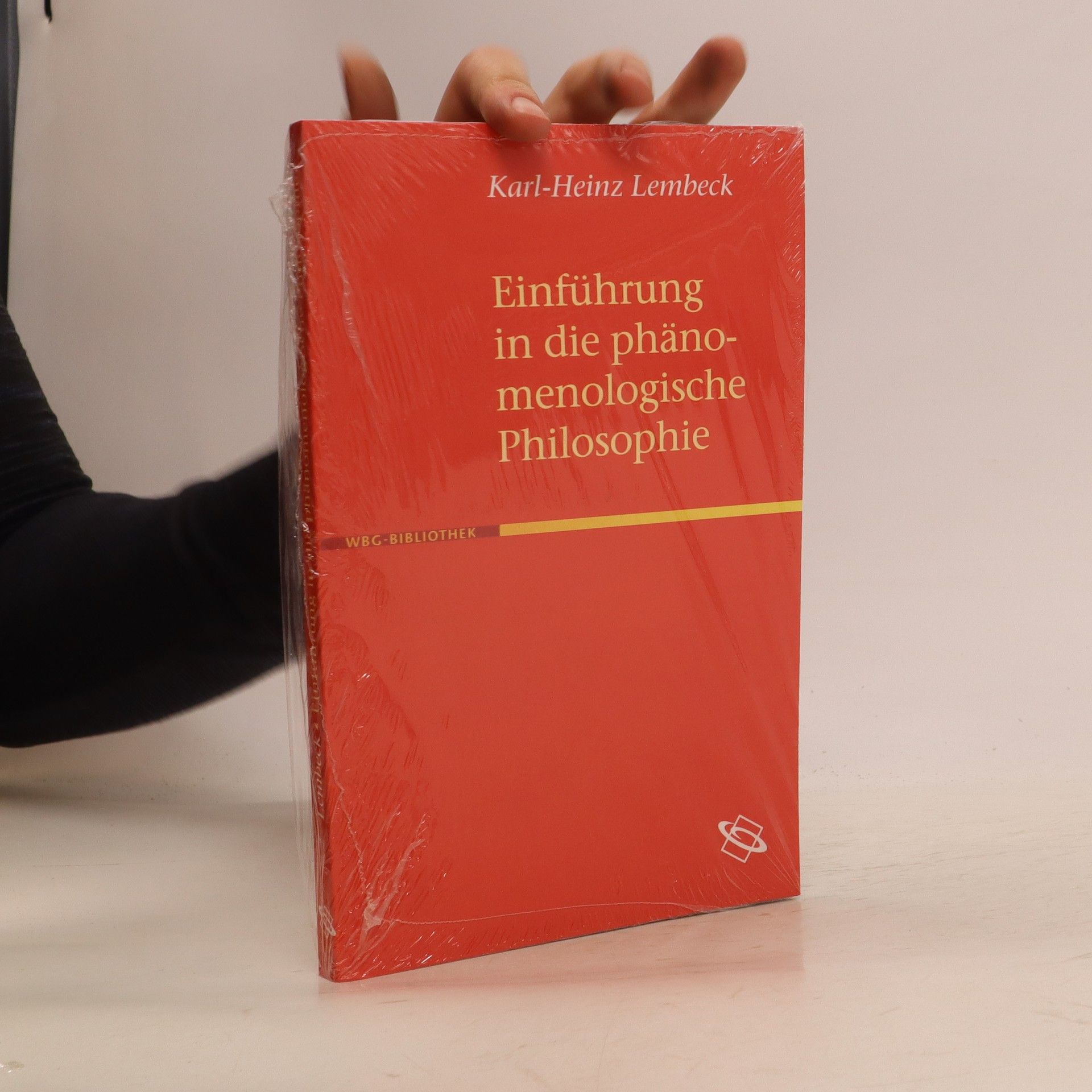Einführung in die phänomenologische Philosophie
- 182bladzijden
- 7 uur lezen
Ausgehend vom epochemachenden Ansatz Edmund Husserls entwickelt der Autor die Grundgedanken dieser Philosophierichtung und stellt einige paradigmatische Rezeptionslinien des Grundkonzepts wie die ontologische Phänomenologie, die hermeneutische Phänomenologie, die Existenzialphänomenologie und die Phänomenologie des Ethischen vor. Sonderausgabe der 1. Aufl. 1994