Martin Poltrum Boeken
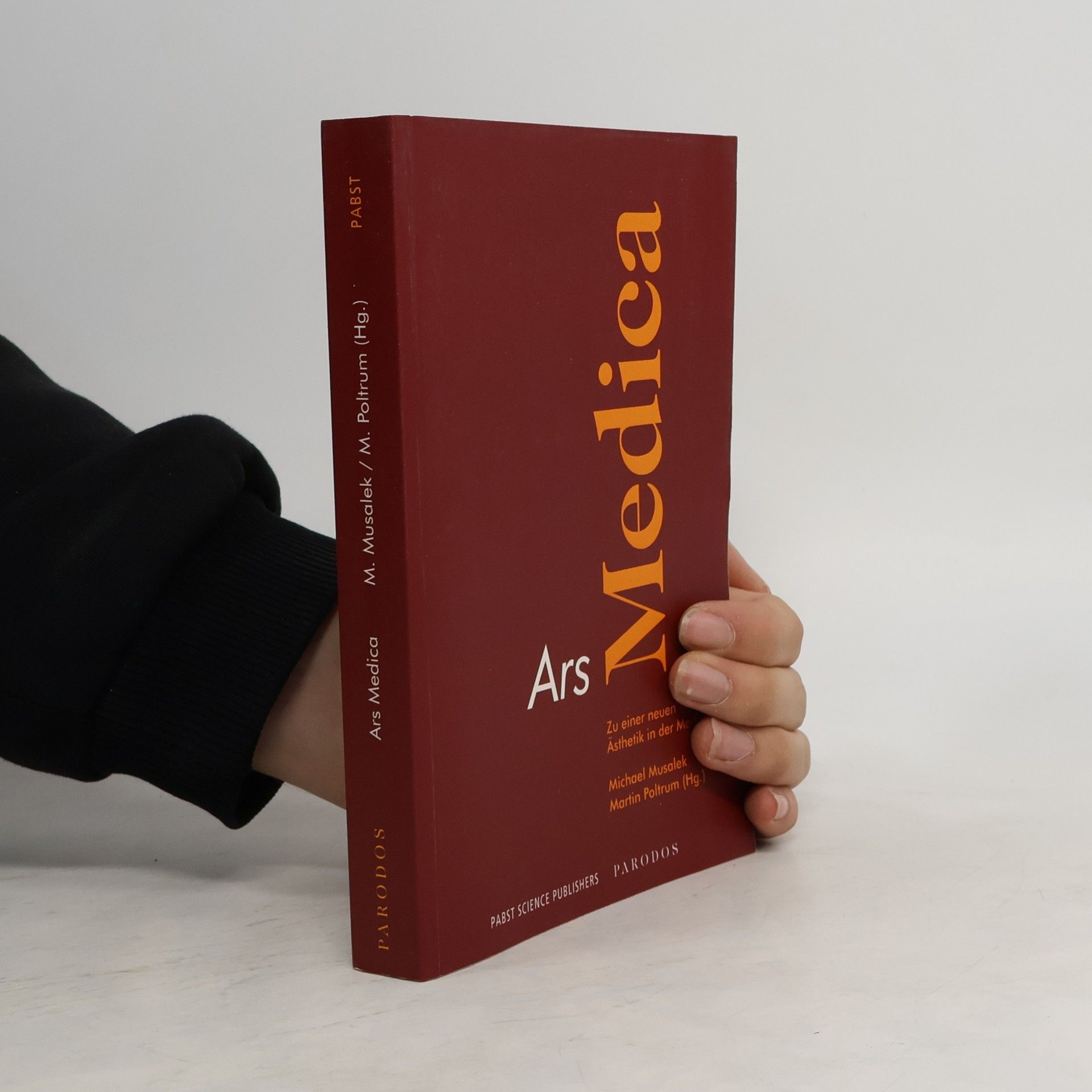



Das wissenschaftliche Interesse an der Darstellung psychischer Störungen in Spielfilmen und Serien boomt, das zeigen Buchpublikationen sowie nationale und internationale Kongressprogramme. Diese Hinwendung zum Film macht deutlich, dass es im Bereich der Psychopathologie wieder eine vermehrte Sehnsucht nach Fallgeschichten gibt, die der gegenwärtigen Orientierung der Psychiatrie an Zahlen, Fakten, Daten und Guidelines ein narratives und hermeneutisches Element entgegensetzen und den Wert des deskriptiven und verstehenden Zugangs zu seelischem Leiden betonen. Von den „Wahnsinnsgeschichten“ und den Geschichten über den Wahn, die uns Filme und Serien erzählen, können Ärzte, Psychiater, Psychologen, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Pflegepersonen, Angehörige von psychisch Kranken, Betroffene und interessierte Laien ebenso wie Medien- und Kulturwissenschaftler daher einiges lernen.
Musen und Sirenen
Ein Essay über das Leben als Spiel
Philosophie besteht nicht aus Worten, sondern aus Taten. Sie bildet und gestaltet die Seele, ordnet das Leben, regelt die Handlungen und zeigt uns, was zu tun und zu lassen ist. Sie steht am Steuer und gibt uns den richtigen Kurs durch die Gefahren der Wellen an. Ohne sie kann niemand furchtlos und sorgenfrei leben. Lucius Annaeus Seneca Gerade das ist es ja, das Leben, wenn es schön und glücklich ist, ein Spiel. Natürlich kann man auch alles andere aus ihm machen, eine Pflicht oder einen Krieg oder ein Gefängnis, aber es wird dadurch nicht schöner. Hermann Hesse