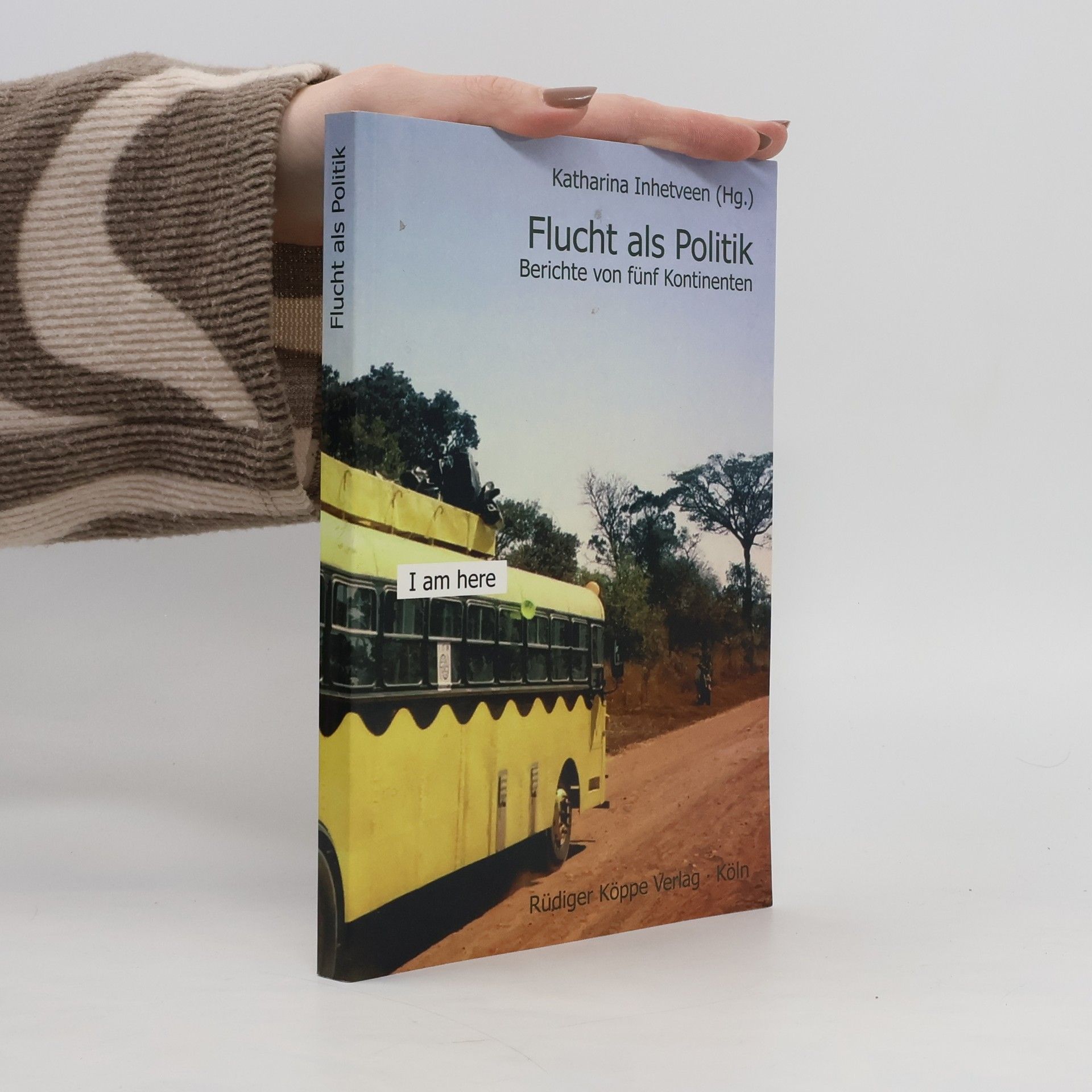Flucht als Politik
- 229bladzijden
- 9 uur lezen
Flucht bezeichnet das räumliche Entziehen von Menschen aus Situationen, in denen sie Gewalt oder andere Bedrohungen erleben. Die Bandbreite der Fluchtfälle ist enorm und hat stets politische Dimensionen. Flucht kann sowohl direkte Folge als auch Ziel von Politik sein, hat politische Konsequenzen und kann als Machtressource für die Flüchtenden fungieren. Das Thema „Flucht als Politik“ zeigt, dass Flüchtlinge aktive Akteure sind und die Sozialwissenschaften nicht das gängige Bild hilfloser Opfer übernehmen sollten. Der vorliegende Band umfasst neun Aufsätze, die empirische Themen von fünf Kontinenten beleuchten. Beiträge aus Soziologie, Politik- und Rechtswissenschaften, Ethnologie und anderen Disziplinen bieten fruchtbare Einblicke über Disziplingrenzen hinweg. Neben Wissenschaftlern sind auch Praktiker beteiligt, die empirische und theoretische Perspektiven zu verschiedenen Aspekten von Flucht und Politik präsentieren. Die Aufsätze behandeln unter anderem die Machtverhältnisse bei Flucht, Strategien von Flüchtlingen sowie deren Rolle als politische Akteure und die Flüchtlingspolitik in verschiedenen Ländern. Die Vielfalt der Themen und Ansätze fördert ein umfassenderes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Flucht und Politik.