Seit 2015 kam mehr als eine Million Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nach Deutschland - viele davon Familien mit Kindern im Grundschulalter. Eine zentrale Aufgabe der Grundschule besteht darin, diesen Kindern soziale und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund fragt dieses Buch: Wie kann es gelingen, die sprachliche und kulturelle Vielfalt so zu nutzen, dass alle an Schule Beteiligten mit- und voneinander lernen können? Das Buch bündelt empirisches Wissen zu diesem Thema, diskutiert Lösungsansätze für den Grundschulalltag und gibt Anregungen für Umsetzungsmöglichkeiten. Jedes Kapitel wird mit Fallbeispielen sowie mit weiterführenden Literatur- und Materialhinweisen gerahmt.
Heike de Boer Boeken

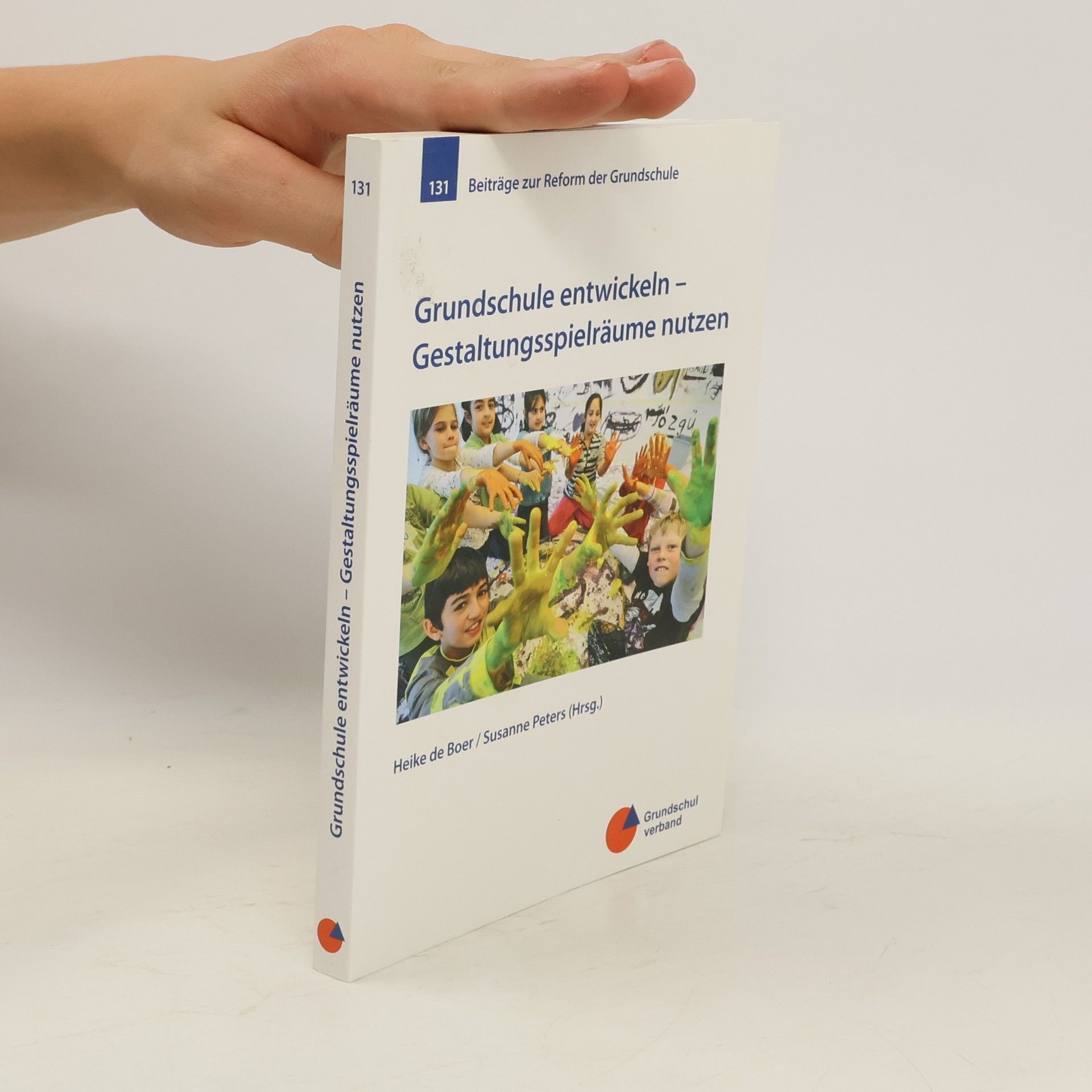


Beobachten im fachdidaktischen Kontext
Schülerinnen- und Schülerperspektiven auf die Bearbeitung von Aufgaben
Im Mittelpunkt dieses Bandes steht die videogestutzte Beobachtung. Auf der Basis von Beobachtungsprotokollen werden Rekonstruktionen der Aufgabenbearbeitung vorgenommen. Fokussiert werden dabei nicht nur Mikroprozesse der Aufgabenbearbeitung, sondern auch die Perspektiven von Schuler*innen auf den fachlichen Lerngegenstand.
„Grundschule entwickeln - Gestaltungsspielräume nutzen“ so lautet der Titel dieses Bandes und schließt damit an die aktuelle Debatte über Schulqualität an. Kriterien für Schulqualität liegen in jedem Bundesland im Kontext der länderspezifischen Orientierungsrahmen vor und werden als Bezugssystem für Fremdevaluationen und Schulinspektionen genutzt. Schulen müssen sich regelmäßig dem Blick externer Evaluation aussetzen und stehen vor der Aufgabe, den wachsenden Leistungsanforderungen der Gesellschaft an die schulische Arbeit Rechnung zu tragen, ohne den pädagogischen Blick auf den einzelnen Schüler/die einzelne Schülerin zu verlieren. Die Bedingungen für Grundschulen in Deutschland sind dadurch gekennzeichnet, dass in der Regel finanzielle und organisatorische Ressourcen für die Einzelschule fehlen. Dass dennoch an vielen Schulen kreative Konzepte und Schulprogramme entstanden sind, dass Schulen voneinander und miteinander lernen können, wird mit diesem Buch gezeigt und damit Anregungen für Schulentwicklungsprozesse gegeben, ohne notwendige bildungspolitische Maßnahmen auszublenden.
Beobachtung in der Schule - Beobachten lernen
- 329bladzijden
- 12 uur lezen
Beobachtungen von Pädagogen und Pädagoginnen in der Schule entfalten Wirkungen. In ihnen und mit ihnen werden Bilder von Kindern und Jugendlichen, von Schülerinnen und Schülern erzeugt, vor deren Hintergrund pädagogisches Handeln stattfindet und pädagogische Entscheidungen gefällt werden. Beobachtungen sind also Teil der alltäglichen pädagogischen Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern. Sie finden überall statt und zugleich zu wenig Beachtung. Hier setzt dieses Lehrbuch an, das diesen zentralen Bestandteil pädagogischen Handelns von Lehrern und Lehrerinnen theoretisch, anhand von Fallbeispielen und methodisch umfänglich darstellt und zudem Möglichkeiten bietet, das Beobachten einzuüben und diese Tätigkeit gleichzeitig zu reflektieren.