Die Dido-Episode der zwischen 1170 und 1190 entstandenen Eneide Heinrichs von Veldeke weist mehrere Szenen auf, die moderne Leser oft als inkohärent empfinden. Didos überschwänglicher Empfang des gestrandeten Eneas und das Unwetter, das ihre Jagd und die Liebesvereinigung vorwegzunehmen scheint, erwecken den Eindruck einer Störung der Erzählung. Dies wirft die Frage auf, ob Didos Liebe zu Eneas die narrative Kohärenz gefährdet. Laut gängiger Forschungsmeinung unterliegen mittelalterliche Erzähltexte weniger strengen Kohärenzanforderungen, wobei Inkohärenz als typisches Stilmerkmal gilt. Diese Beurteilung könnte jedoch auf einem historisch begrenzten Kohärenzbegriff basieren. Die Untersuchung widmet sich dieser Fragestellung, indem sie am Beispiel der Dido-Episode Konzepte narrativer Motivation kritisch analysiert. Im Gegensatz zum kausalen Kohärenzmodell der modernen Narratologie wird ein erweitertes systematisches Kohärenzmodell entwickelt. Dieses Modell berücksichtigt sowohl die Oberflächeneigenschaften als auch die thematische Sinnbildung narrativer Texte. Dadurch wird nicht nur der Literarizität Rechnung getragen, sondern auch die oft bemühte Finalität in der Interpretation mittelalterlicher Erzählungen als Effekt spezifischer, historisch und gattungstypisch variabler Erzählstrukturen beschrieben.
Anne Sophie Meincke Volgorde van de boeken
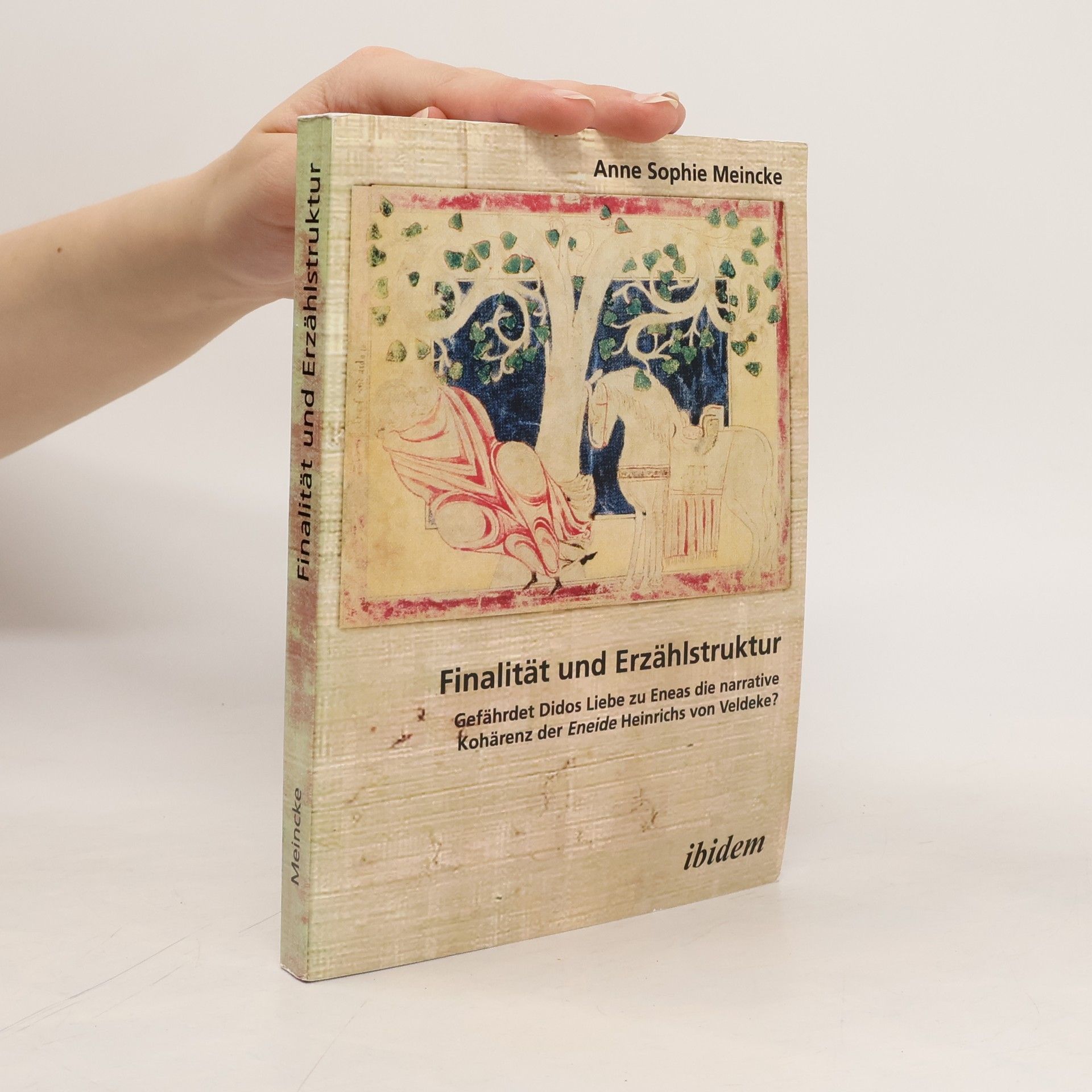
- 2007