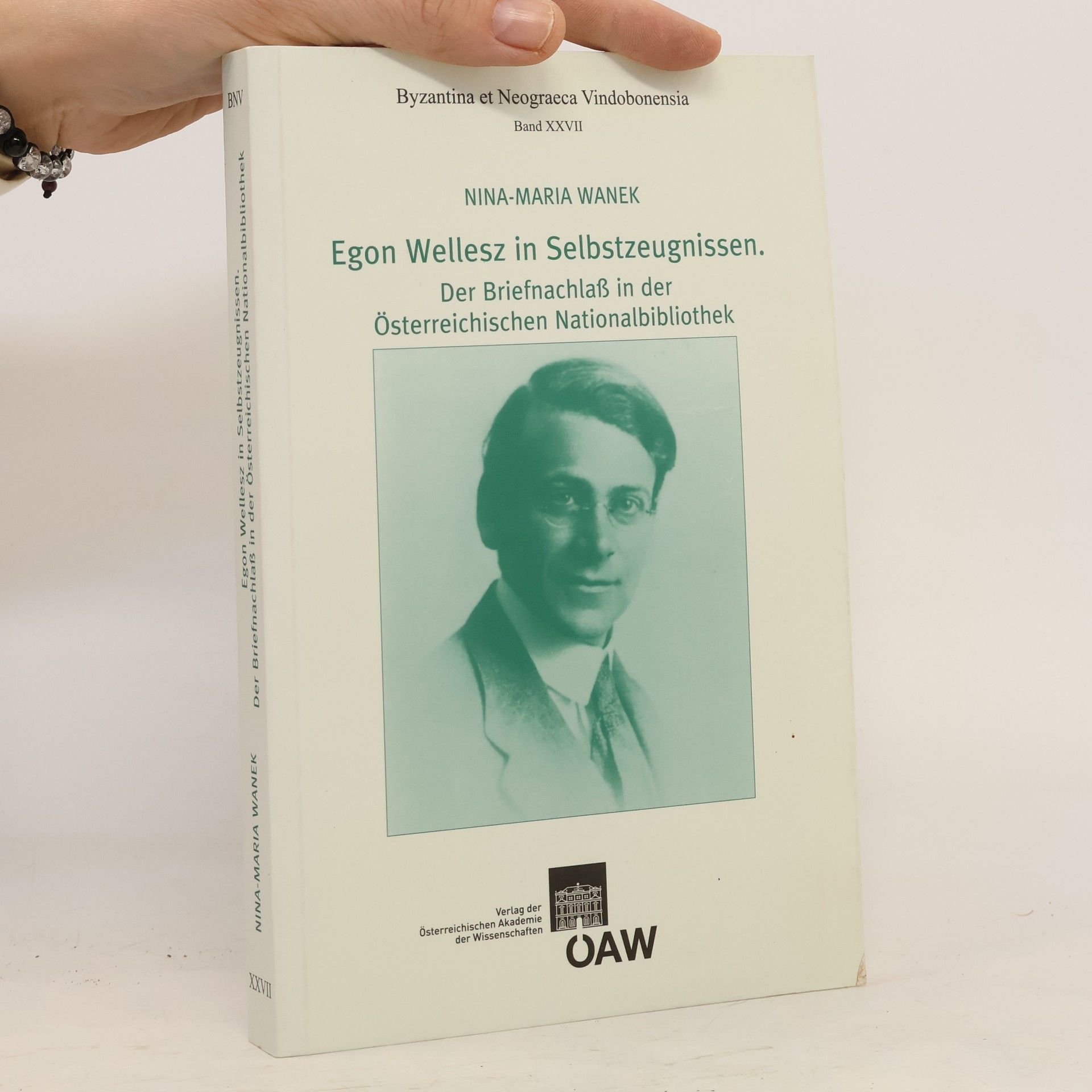Egon Wellesz in Selbstzeugnissen
- 268bladzijden
- 10 uur lezen
Egon Wellesz (1885–1974) wird oft als Komponist, Musikwissenschaftler, Byzantinist, Emigrant oder Lehrer beschrieben. Doch wer war er wirklich? Der vorliegende Band nutzt seinen Briefnachlass aus der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, um diese Frage zu klären. In etwa 9000 nachgelassenen Briefen begegnet man Wellesz als Mensch, der direkt und unverfälscht kommuniziert. Dieser umfangreiche und aufschlussreiche schriftliche Nachlass wurde bisher nicht wissenschaftlich bearbeitet. Die Selbstzeugnisse Wellesz’ beleuchten seine Forschungen in Wien und Oxford, seine Kompositionstätigkeit, seine Beziehung zu Österreich und seinen Austausch mit der geistigen Elite des 20. Jahrhunderts. Die Briefe bieten Einblicke in das Leben und Werk eines der vielseitigsten Musikschaffenden und Wissenschaftler des letzten Jahrhunderts sowie in das Musik- und Universitätsleben Wiens. Da viele seiner Briefpartner im Ausland lebten, reicht der Einfluss seiner Korrespondenz über nationale Grenzen hinaus. Die Auswertung dieser Briefe liefert zahlreiche neue Erkenntnisse, die für zukünftige Forschungen in der Musikgeschichte von Bedeutung sind. Im Anhang sind ausgewählte Briefe von Wellesz enthalten.