Buchners Kolleg Geschichte, Ausgabe C, Die Herausbildung des modernen Europa
- 224bladzijden
- 8 uur lezen
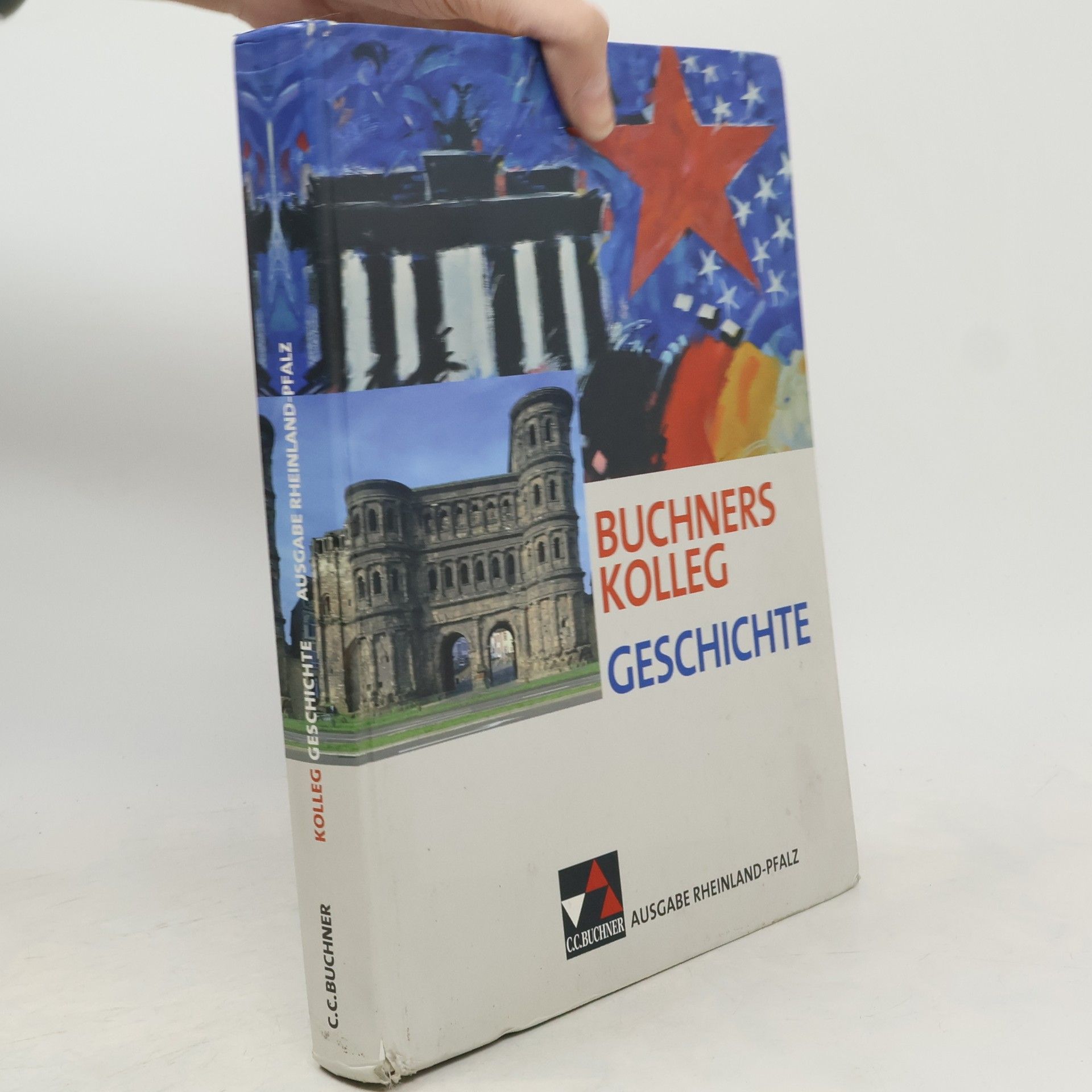

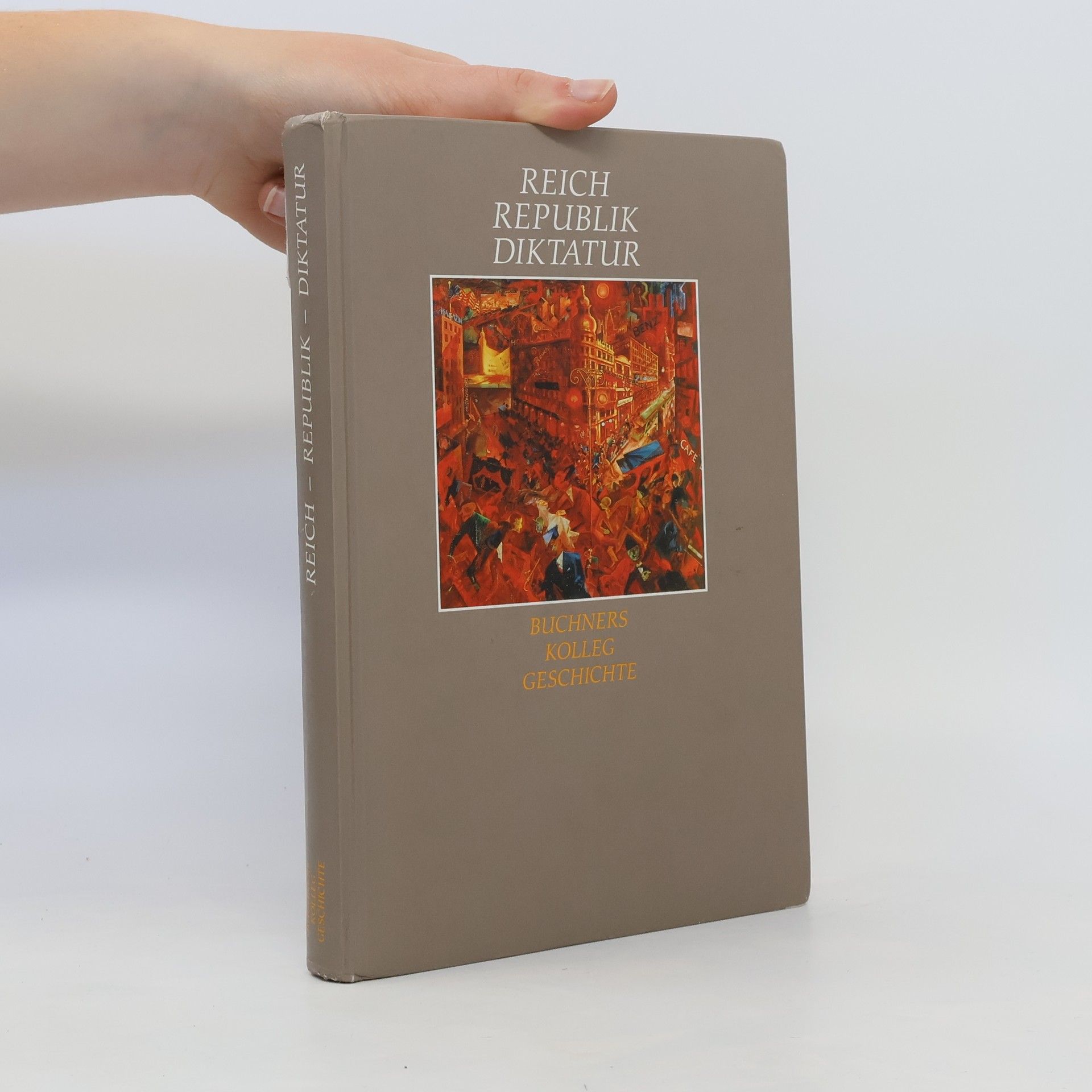

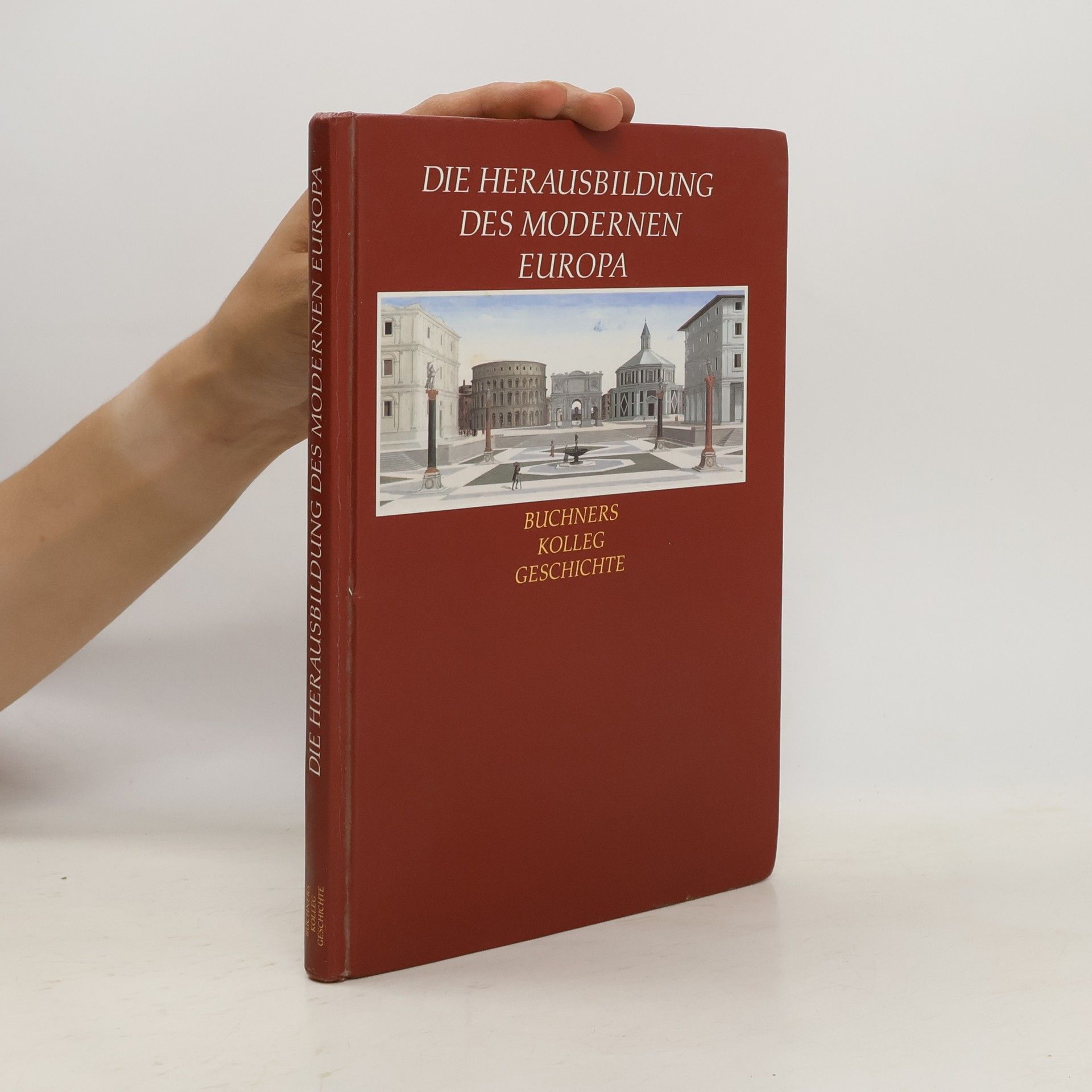
Johann Galster (1868-1947) war von 1893 bis 1919 Stadtpfarrer in Erlangen und kümmerte sich auch um katholische Soldaten. Das Buch beleuchtet sein Wirken und das katholische Leben in der protestantisch geprägten Stadt, insbesondere während des Ersten Weltkriegs. Es richtet sich an ein breites Publikum und bietet Einblicke in die religiöse Geschichte der Stadt.