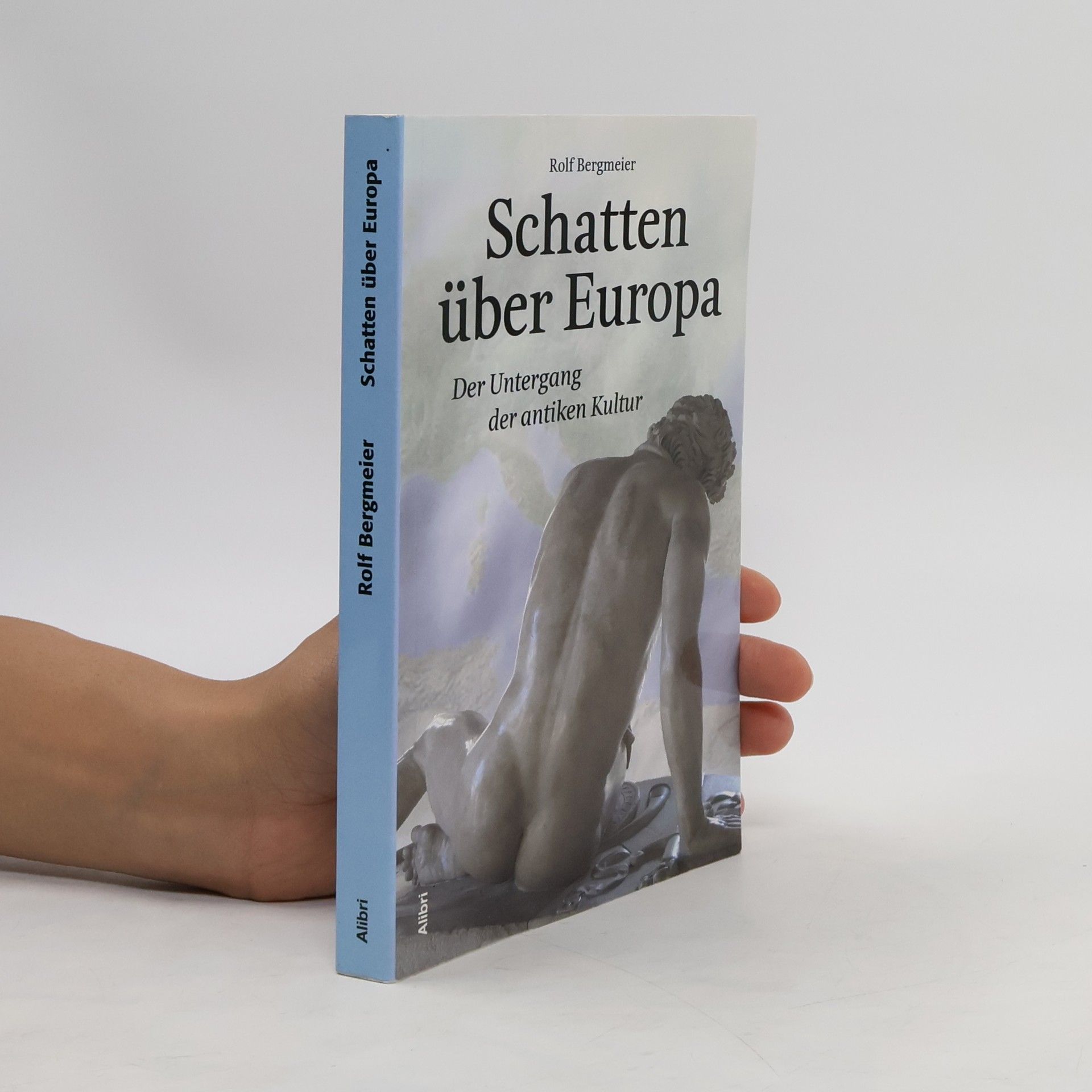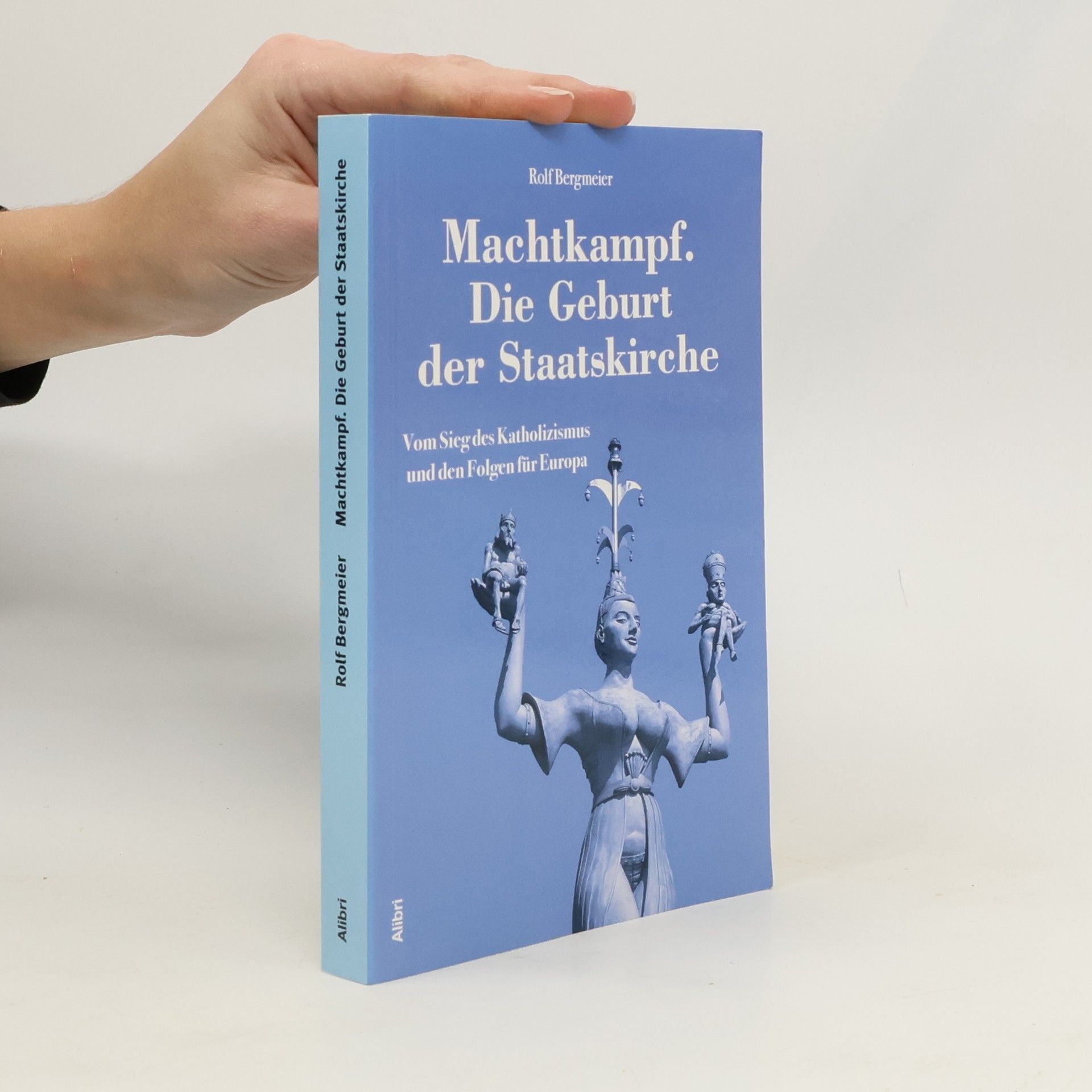Machtkampf. Die Geburt der Staatskirche
Vom Sieg des Katholizismus und den Folgen für Europa
Am 28. Februar 380 wird die Grundlage für eine der folgenreichsten Veränderung der Welt gelegt. Der römische Kaiser Theodosius erlässt das Edikt Cunctos populos und unterwirft damit alle Bürger des römischen Reiches einer Religion, die er katholisch nennt. Von nun an sind Staat und katholische Kirche untrennbar miteinander verbunden. So entsteht eine machtvolle Verflechtung von explosiver Kraft, die Europa fast 1500 Jahre beherrschen und deren Wirkung bis in die Spitzen Südamerikas reichen wird. Die wenigen Zeilen des Ediktes bilden die Ouvertüre zu einer Gesellschafts- und Kulturrevolution, die Europa grundlegend verändert. Das Buch analysiert, warum die kulturellen, zivilisatorischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in Mitteleuropa für mehr als tausend Jahre einen Tiefstand erreichen, und wie der weltliche und klerikale Feudalismus die gesellschaftliche Entwicklung lähmt. Es beschreibt, wie sich der Katholizismus vom ursprünglichen Christentum trennt und es deshalb falsch ist, vom christlichen Abendland zu sprechen: Das Mittelalter ist katholisch und nicht christlich.