EU Recht
Sammlung Rechttexte

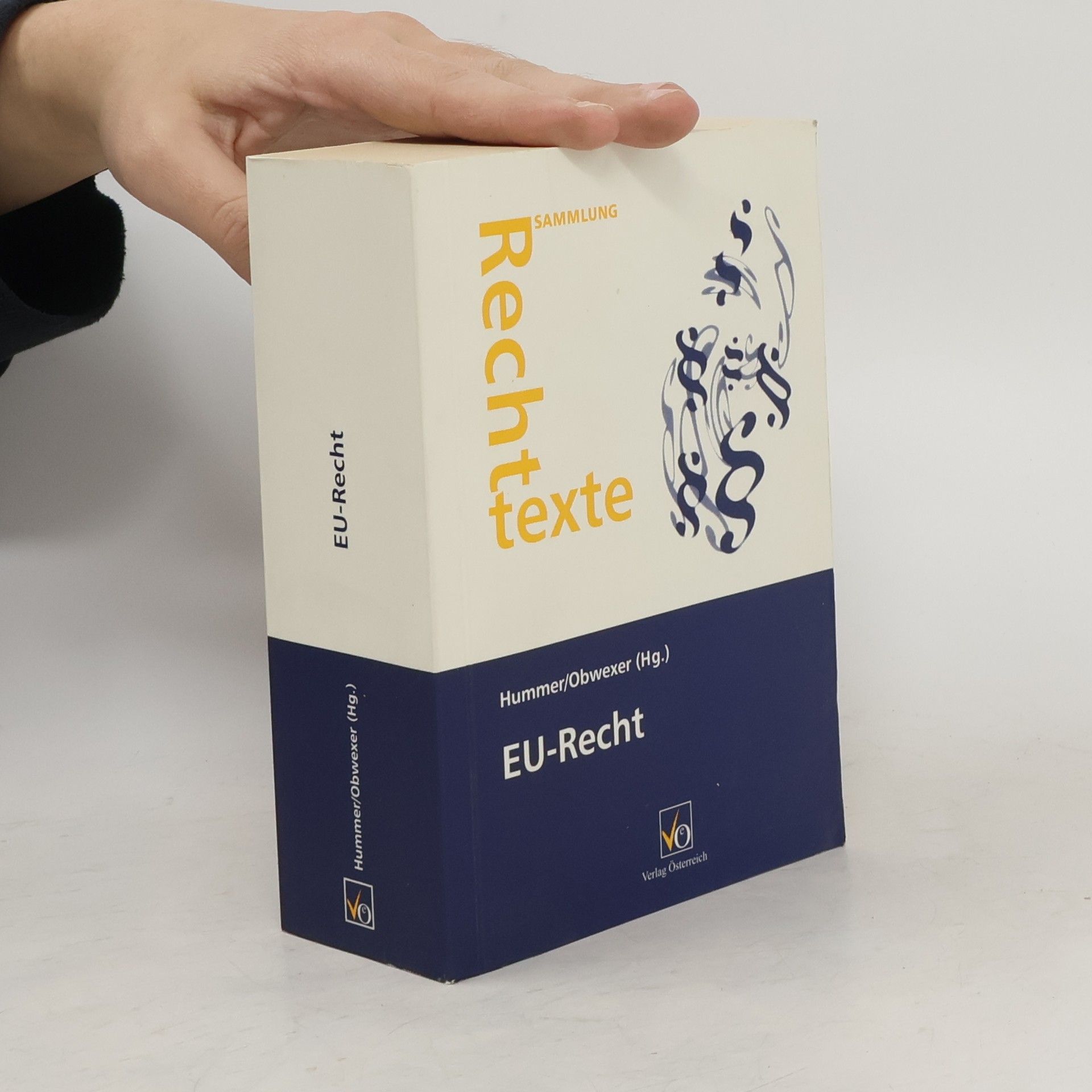
Sammlung Rechttexte
Das Buch "elements Europarecht" fördert das praxisnahe Erlernen der Grundlagen des EU-Rechts und erleichtert die Prüfungsvorbereitung. Es behandelt zentrale Themen wie Rechtsakte, Gerichtssystem und Grundfreiheiten und integriert relevante Judikatur. Interaktive Elemente wie Lückentexte und Fälle unterstützen das Lernen. Ideal für Studierende in Österreich und Deutschland.