Mark Mersiowsky Boeken
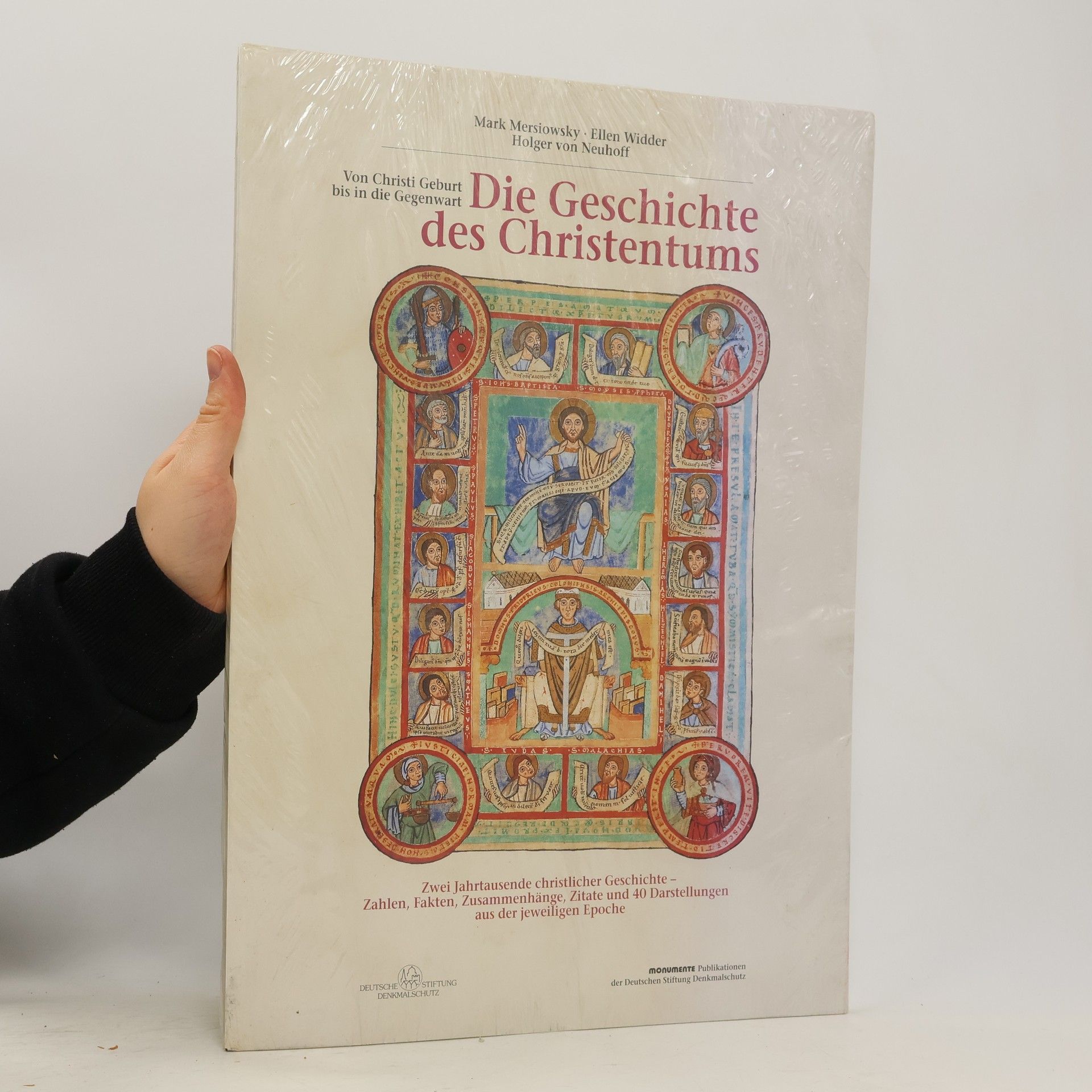

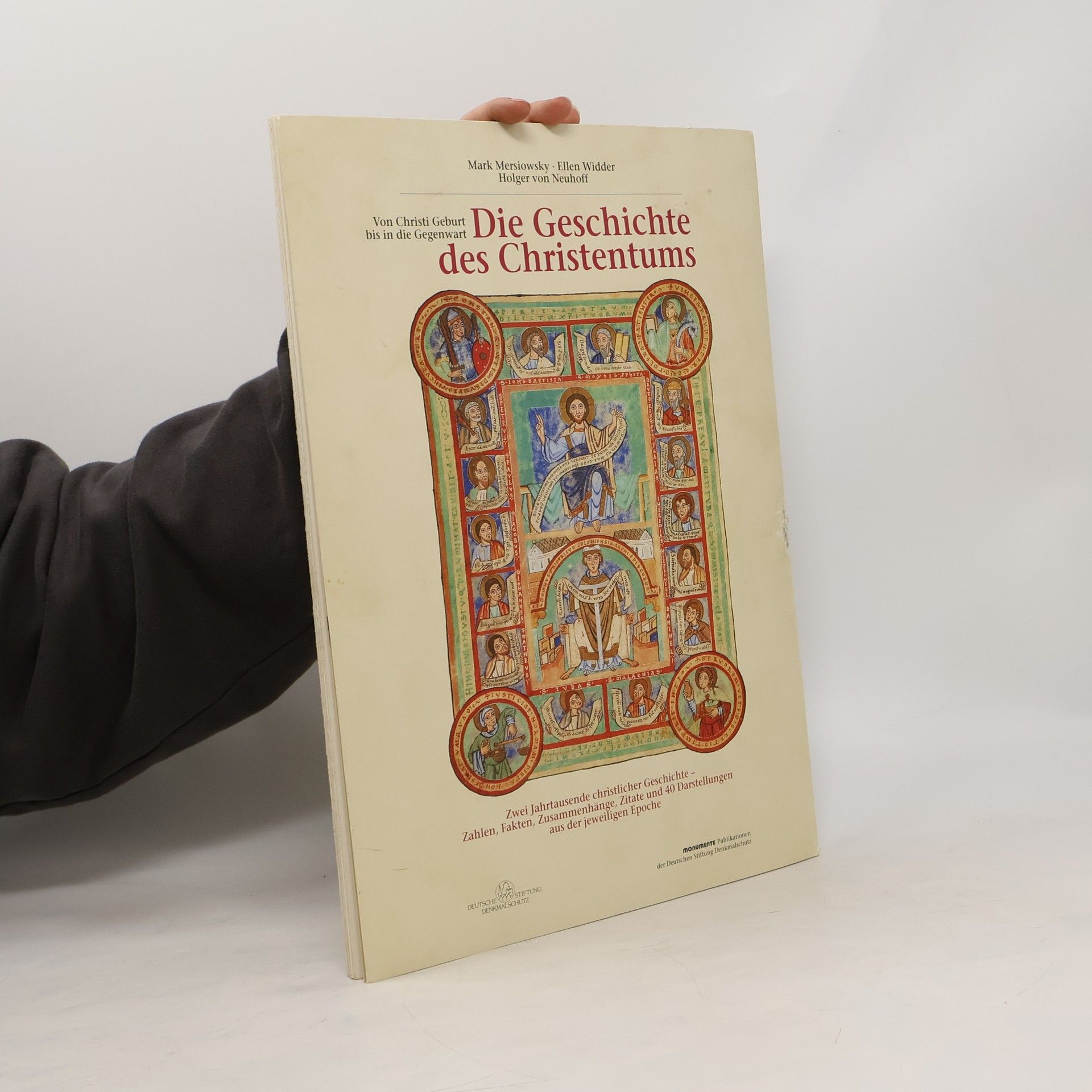
Von Preußenland nach Italien
Beiträge zur kultur- und bildungsgeschichtlichen Vernetzung europäischer Regionen
Dieser Band enthält Beiträge einer internationalen Tagung, die die Kulturkontakte zwischen dem südlichen Ostseeraum und Italien vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert untersucht, mit einem besonderen Fokus auf Tirol als Vermittler. Seit dem Hochmittelalter gab es intensive wechselseitige Kulturbeziehungen, insbesondere durch den Deutschen Orden und seine Ballei in Tirol. Adelige Italiener unterstützten den Orden im Heidenkrieg, während der Humanist Enea Silvio Piccolomini nach dem Bischofssitz in Frauenburg strebte, bevor er Papst Pius II. wurde. Italienische Universitäten bildeten preußische Studenten aus, und die Jesuiten verwalteten die Schule auf der Marienburg. Die Ideen von Immanuel Kant fanden in Italien begeisterte Anhänger, und der Ostpreuße Gregorovius durchwanderte das Land seiner Sehnsucht. Der Inhalt umfasst verschiedene Themen, darunter die Rolle der Deutschordens-Kammerballei, die Verbindung zwischen dem Deutschen Orden und Venedig, sowie die Ausbildung preußischer Jura-Studenten in Italien. Weitere Beiträge befassen sich mit der Beziehung zwischen dem Deutschen Orden und der Grafschaft Tirol sowie der Konfessionalisierung durch die Jesuiten. Auch die Einbürgerung Kants in die italienische Philosophie-Tradition wird behandelt, ergänzt durch einen Literaturbericht zu Karl Werner.
Die Geschichte des Christentums
Von Christi Geburt bis in die Gegenwart; zwei Jahrtausende christlicher Geschichte - Zahlen, Fakten, Zusammenhänge, Zitate und 40 Darstellungen aus der jeweiligen Epoche
- 24bladzijden
- 1 uur lezen