Über kaum ein anderes Land wird in Deutschland so viel geredet und gestritten: Zu Israel hat jeder eine Meinung. Warum ist das so? Wieso hat der Nahostkonflikt eine solche Bedeutung? Und warum ist die Debatte so emotional – und oft so vergiftet? Als Meron Mendel vor zwanzig Jahren nach Deutschland kam, stellte er überrascht fest, welche Bedeutung sein Heimatland Israel hier im öffentlichen Diskurs hatte. Schon damals konnten nahezu alle, mit denen er sprach, klare Positionen zu Israel und seiner Politik formulieren. Heute werden die Debatten noch heftiger geführt. Zuletzt haben sich Skandale aneinandergereiht – vom öffentlichen Streit um den antiisraelischen Philosophen Achille Mbembe im Jahr 2020 bis zur Documenta-Debatte von 2022. Einerseits wird eine Art „Freundschaftspflicht“ aufgrund der NS-Vergangenheit und dem andauernden Antisemitismus in Deutschland proklamiert. Andererseits stellt sich die Frage, wie Deutschland auf den sich verschärfenden Rechtskurs der Regierung in Jerusalem reagieren soll. Meron Mendel schildert in diesem Buch, wie das Verhältnis zu Israel und zum Nahostkonflikt in Deutschland verhandelt wird, in der Politik und in den Medien, unter Linken, unter Migranten und unter Juden. Deutschlands Verhältnis zu Israel steht vor großen Herausforderungen: Meron Mendel zeigt, wie wir ihnen mit Mut und Offenheit begegnen können.
Meron Mendel Boeken
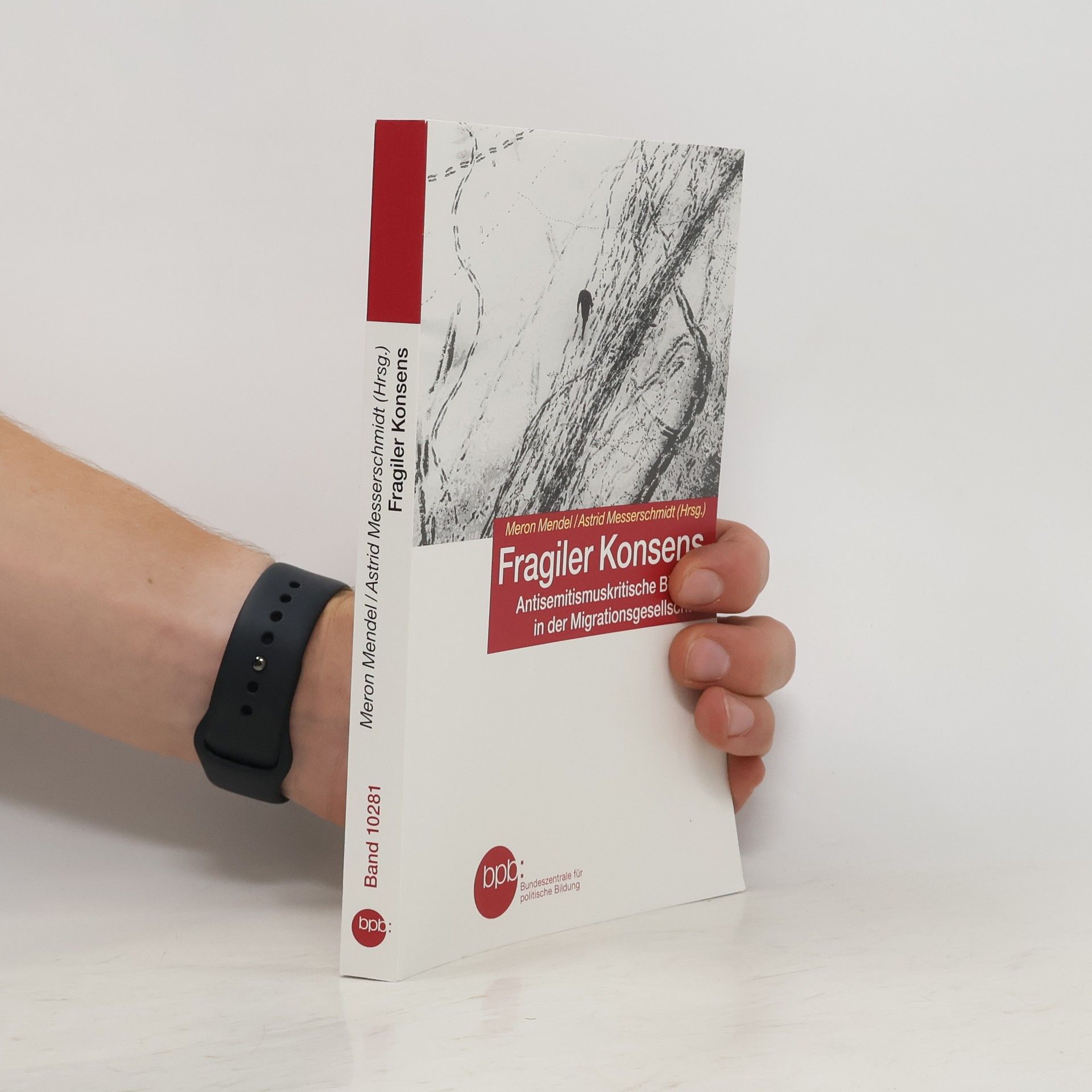



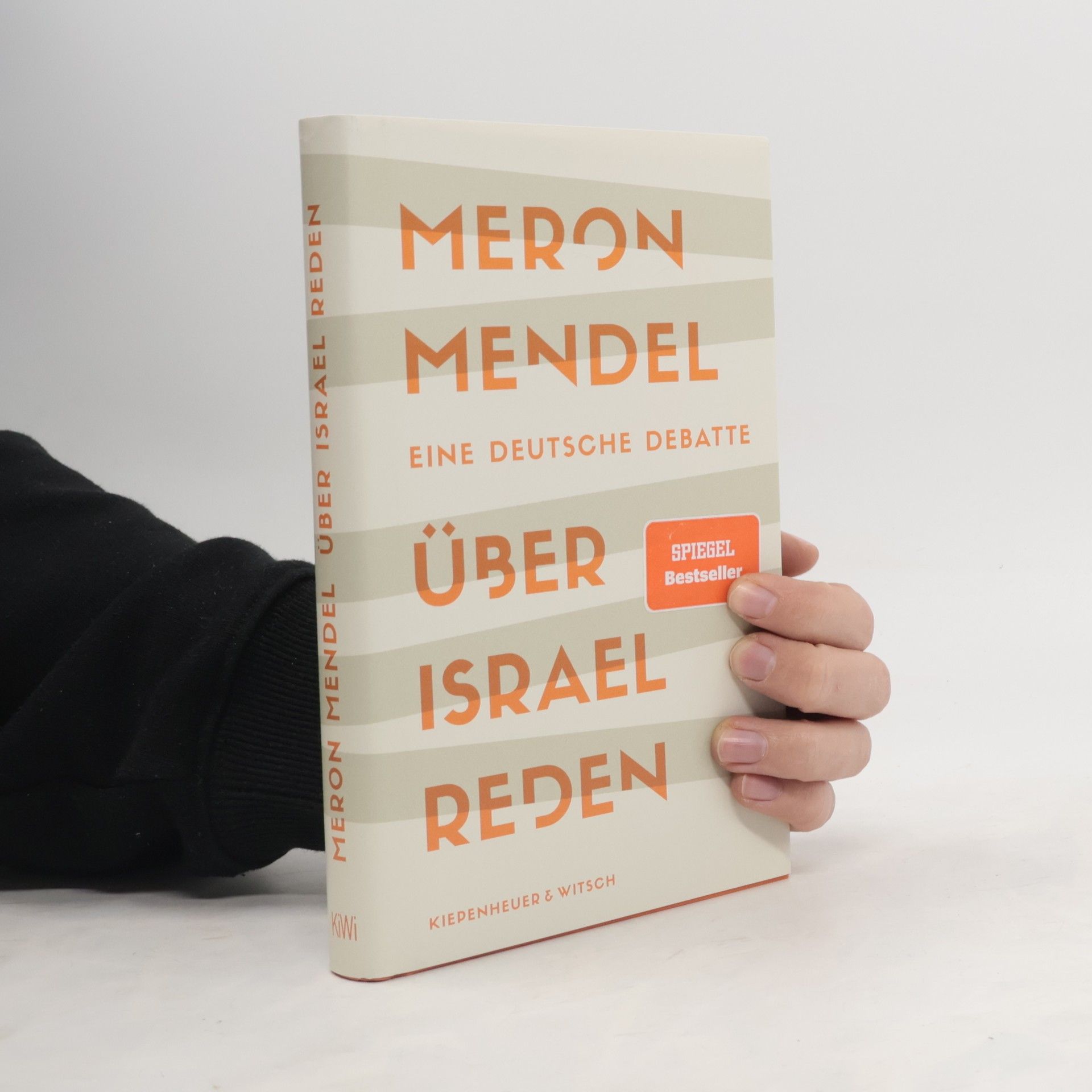
Muslimisch-jüdisches Abendbrot. Das Miteinander in Zeiten der Polarisierung
- 208bladzijden
- 8 uur lezen
Saba-Nur Cheema und Meron Mendel reflektieren in ihrem Buch über die wachsende Unversöhnlichkeit zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen. An ihrem Abendbrottisch diskutieren sie alltägliche und gesellschaftliche Themen, entdecken Gemeinsamkeiten und plädieren für Offenheit und Dialog in einer polarisierten Welt.
Frenemies
Antisemitismus, Rassismus und ihre Kritiker*innen
Eigentlich könnte doch alles ganz einfach sein, oder? Antisemitismus und Rassismus sind beides menschenfeindliche Einstellungen, die von allen bekämpft werden müssen; die Kritik dieser Ideologien müsste deshalb stets zusammen geleistet werden. In der Praxis kommt es jedoch immer wieder zu Unvereinbarkeiten, handfesten Auseinandersetzungen und Grabenkämpfen, mit wechselseitigen Ausschlüssen, Relativierungen, Beschuldigungen und einem Klima des Argwohns. Hinzu kommt, dass die historischen und theoretischen Bezugnahmen von Rassismus- und Antisemitismuskritik sehr verschieden sind. »Frenemies« umzirkelt das Problemfeld, fragt nach den Gründen der Auseinandersetzungen, sucht nach Gemeinsamkeiten, ohne dabei Unvereinbarkeiten und Selbstansprüche der beiden Kritikformen zu relativieren. Das Buch versammelt kurze Texte von Forscher*innen, Bildungspraktiker*innen, Aktivist*innen, die jeweils als Antworten zu »naiven Fragen« dargestellt werden – in Form eines »FAQ«. Was unterscheidet Antisemitismus und Rassismus? Gibt es Verbindungen zwischen Nationalsozialismus und Kolonialismus? Ist BDS antisemitisch? Sind Juden und Jüdinnen »weiß«? Wie werden diese Debatten in anderen Ländern geführt? Der Anspruch des Buches ist es, einen niedrigschwelligen Einstieg in ein komplexes, wenngleich sehr präsentes und konfliktreiches Themenfeld zu liefern. Die Schwerpunkte liegen auf Antisemitismus, antimuslimischem und anti-Schwarzem Rassismus.
Die Schatten der deutschen Kolonialverbrechen und des Holocausts reichen bis in die Gegenwart. In welchem Verhältnis stehen die Erinnerungen an diese Ereignisse zueinander? Erleben wir aktuell eine Zunahme von Opferkonkurrenzen oder ergänzen sich die unterschiedlichen Erinnerungskulturen in Form einer »multidirektionalen Erinnerung« (Michael Rothberg)? Und steht die These der Einzigartigkeit oder Präzedenzlosigkeit des Holocausts (Yehuda Bauer) im Wege, wenn es darum geht, andere Genozide, etwa während der Kolonialzeit, aufzuarbeiten?
Fragiler Konsens
antisemitismuskritische Bildung in der Migrationsgesellschaft