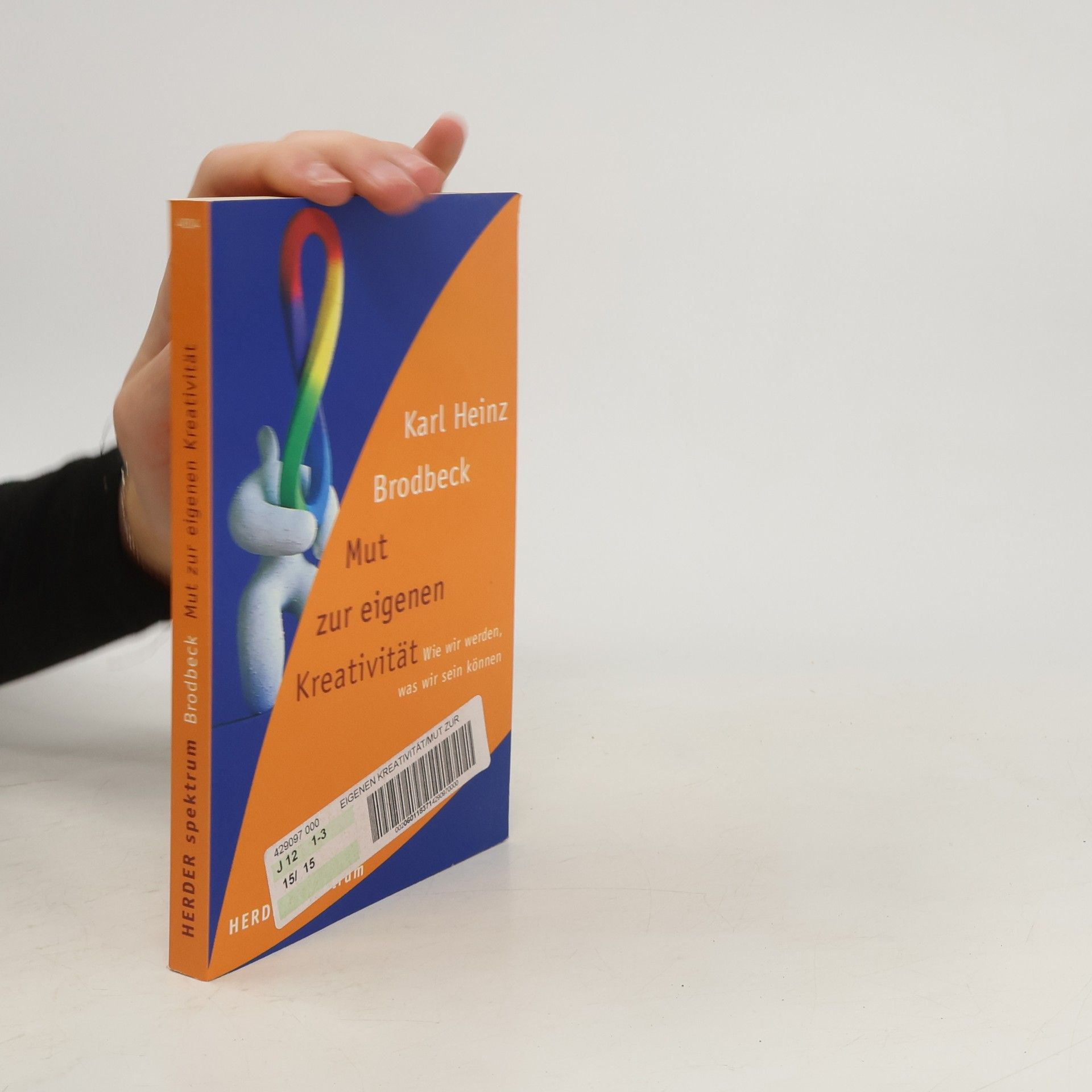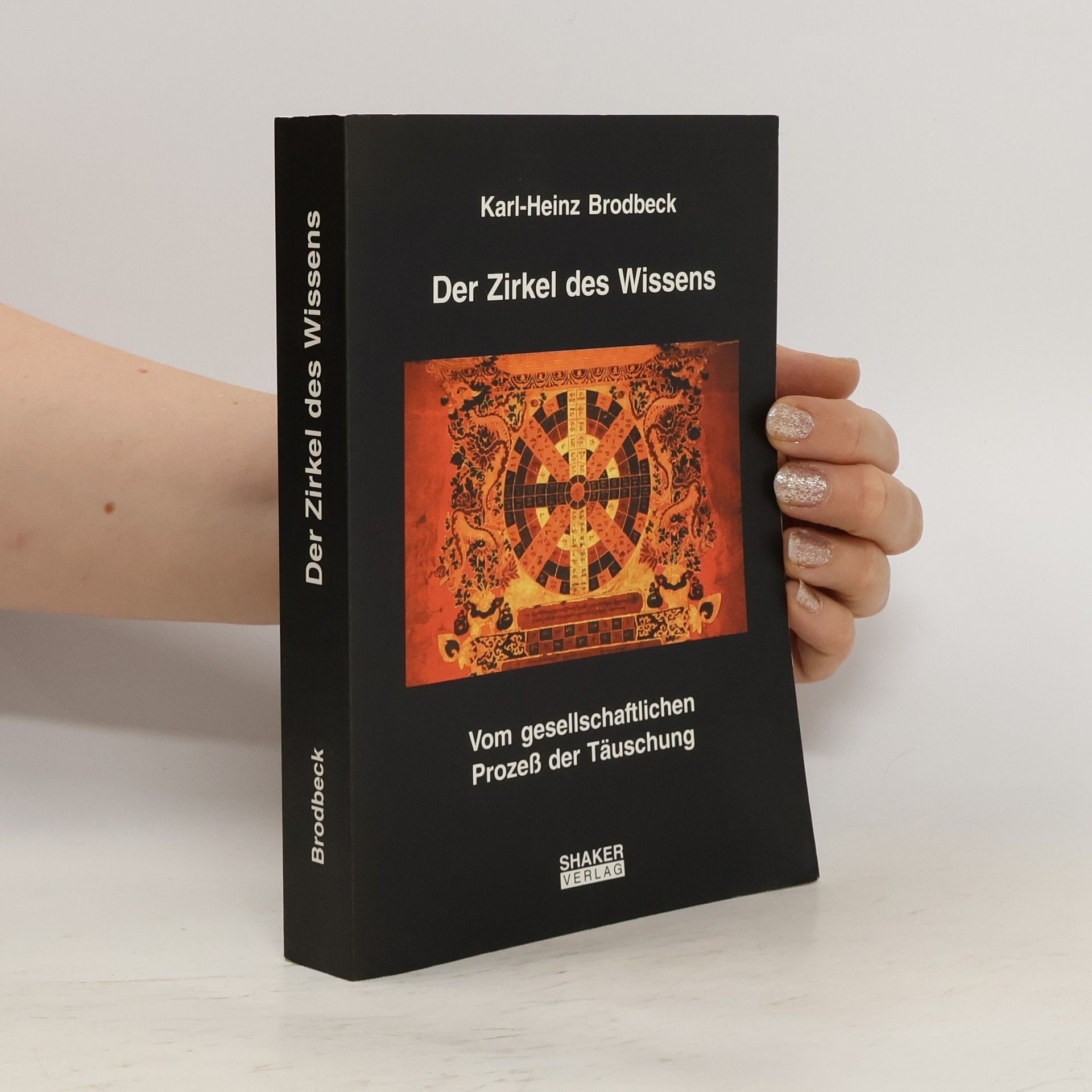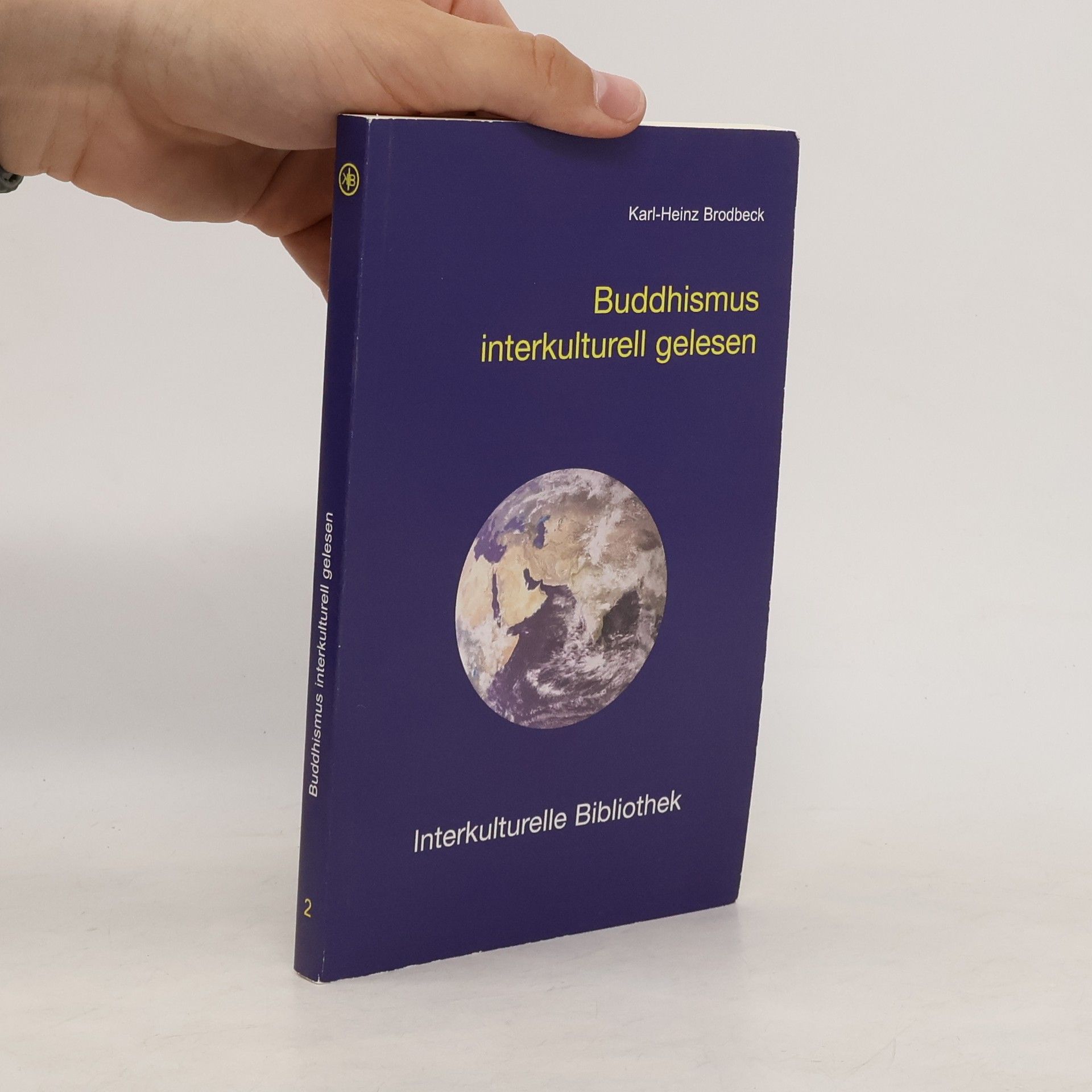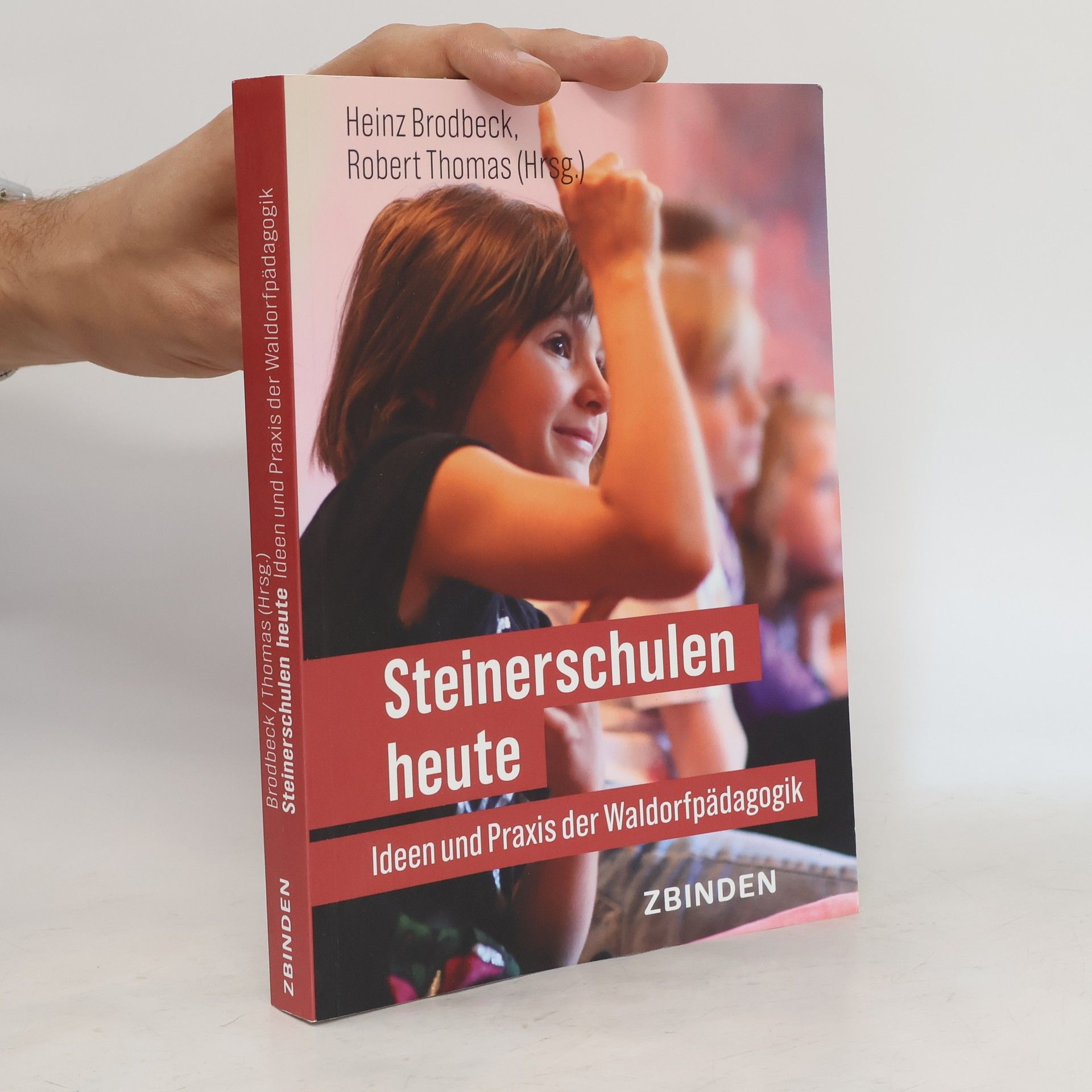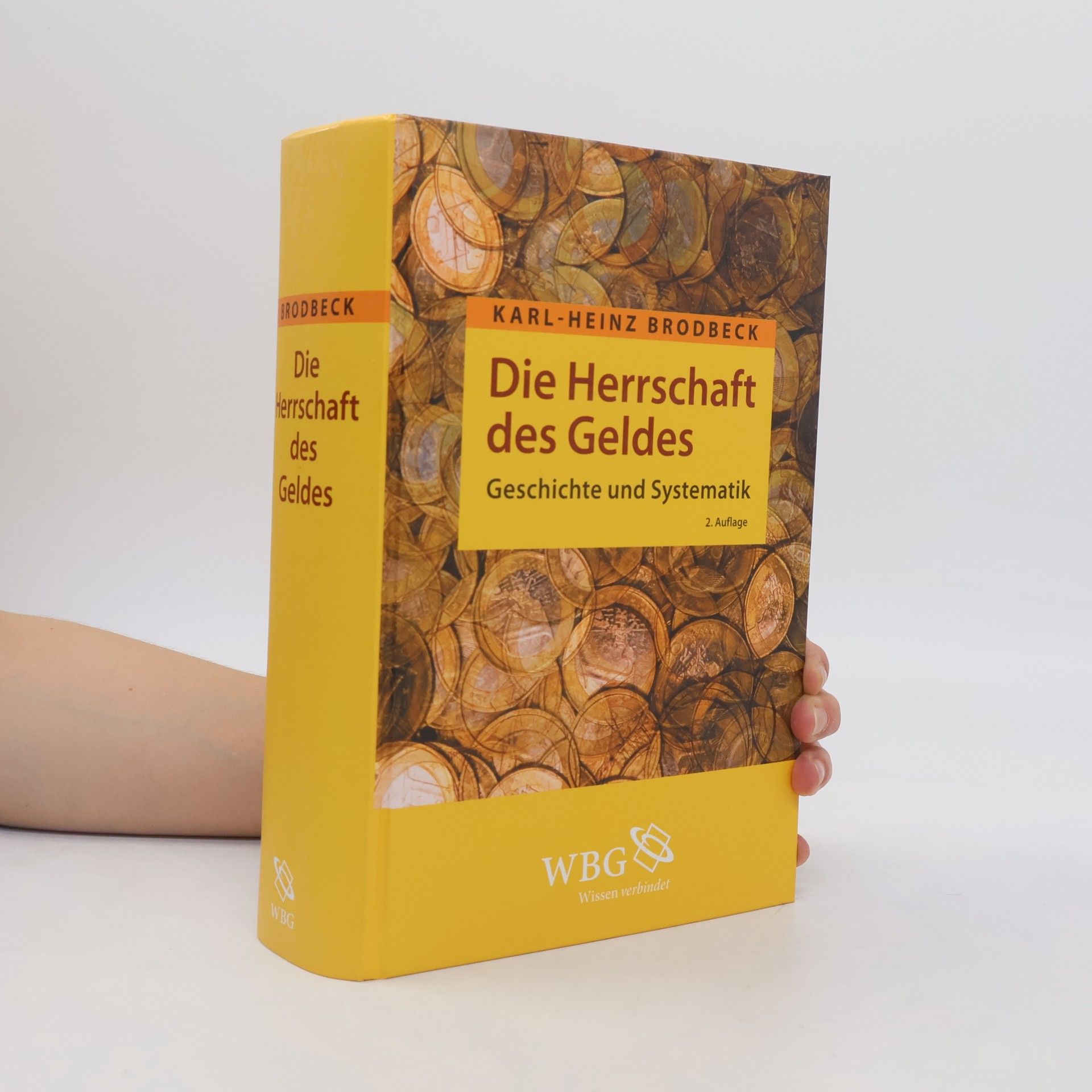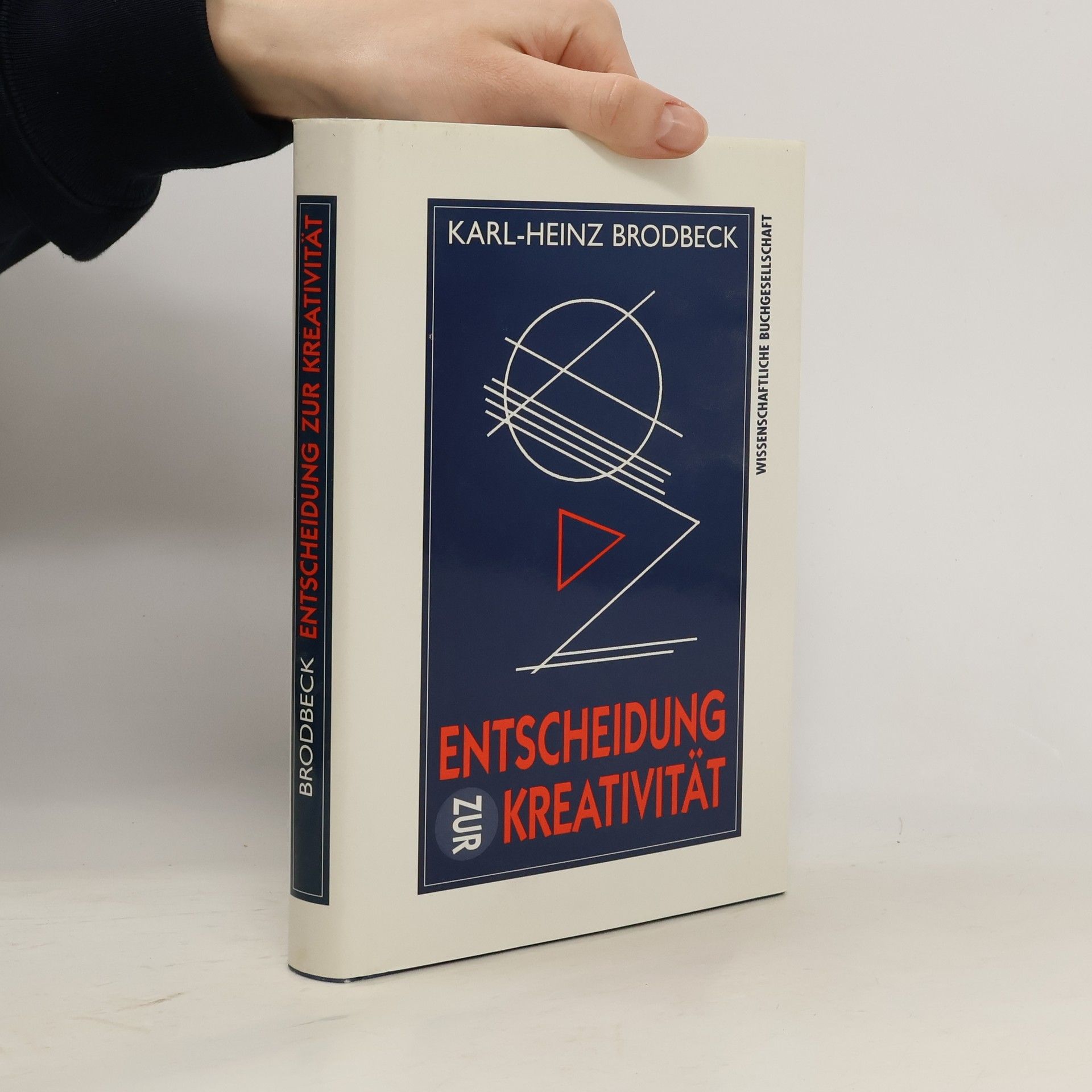Buddhistische Wirtschaftsethik
- 177bladzijden
- 7 uur lezen
Der Buddhismus leistet einen fundierten Beitrag zur ethischen und ökonomischen Diskussion. Die buddhistische Wirtschaftsethik ist keine bloße moralische Hülle, sondern trifft ins Zentrum der blinden Dynamik ökonomischer Prozesse. Sie betrachtet den Buddhismus als „Wissenschaft des Geistes“, deren Praxis durch universelles Mitgefühl, Toleranz und Gewaltfreiheit geprägt ist. Diese Praxis richtet sich gegen die Täuschungen, die menschliches Handeln von vermeintlichen „Sachzwängen“ abhängig machen. Ohne eine spirituelle Perspektive bleibt die Erde in einem heillosen Zustand, der durch Egoismus, Konkurrenz und Zynismus in Wirtschaft und Politik geprägt ist. Diese fehlende Perspektive hat sozialistische und neoliberale Experimente in die Sackgasse geführt. Spiritualität bedeutet im Buddhismus Weisheit des Mitgefühls. Der Kern des Entwurfs ist zu zeigen, wie die Einheit von Erkenntnis und Ethik in Wissenschaft und Praxis der Wirtschaft möglich und notwendig ist. Während die Wirtschaftswissenschaft von einer unveränderlich egoistischen Menschennatur ausgeht, sieht die buddhistische Wirtschaftsethik den Egoismus als negative Gewohnheit, die veränderbar ist. Dieser Egoismus, der in fundamentaler Unwissenheit wurzelt, führt zu Gier und Aggression, die sich in der Wirtschaft als Geld- und Profitgier manifestieren. Veränderungen sind nur möglich, wenn sich die Motivation aller Beteiligten im Wirtschaftsprozess ändert.