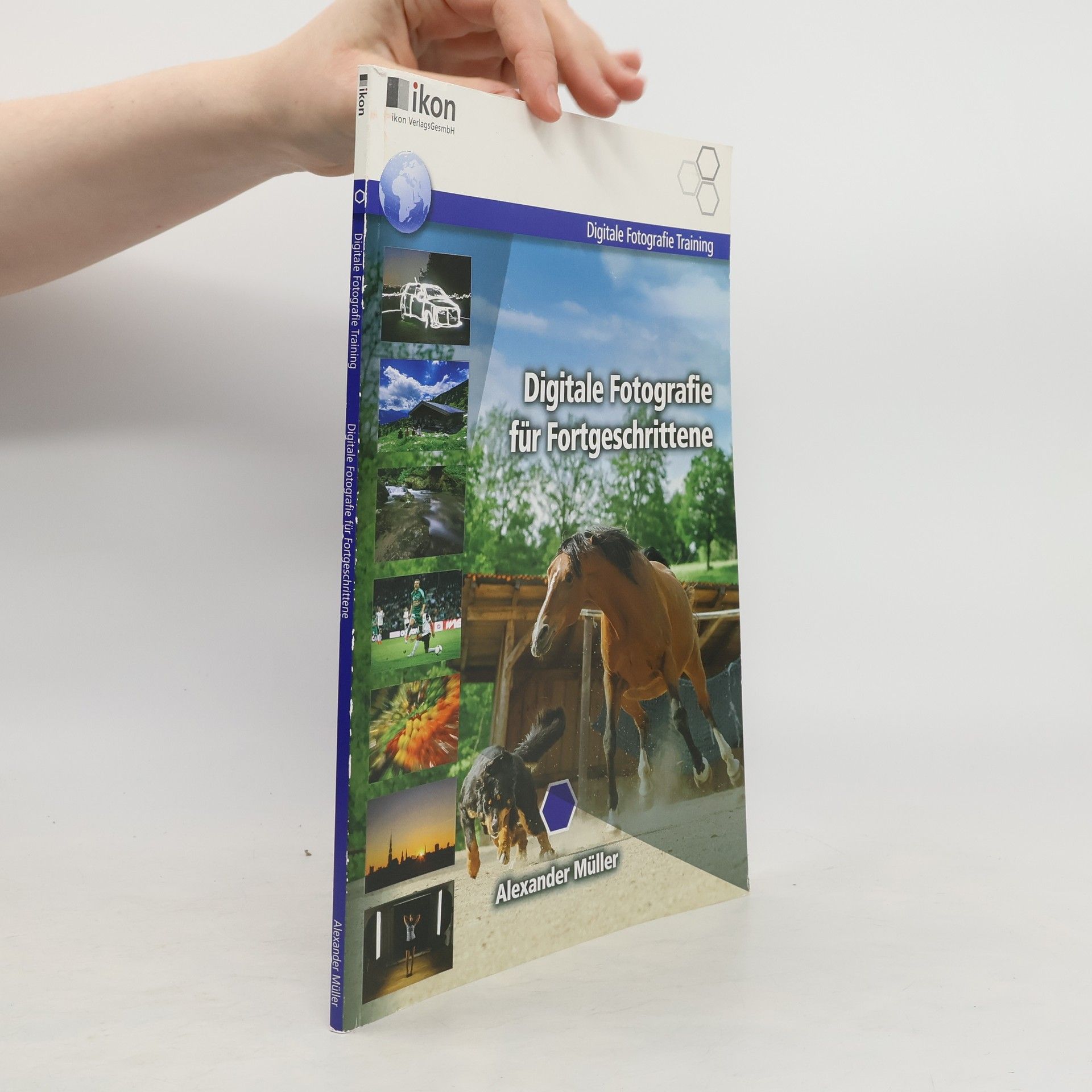Glaubensätze erkennen und aufbrechen. Visionen entwickeln und umsetzen. Glücklich leben. In jedem Menschen steckt das Potenzial, erfolgreich und glücklich zu sein. Wer bereit ist, an sich selbst zu arbeiten, seine Fähigkeiten zu entwickeln und Hindernisse zu überwinden, wird aus diesem Potenzial schöpfen können. Auf dem Weg zu diesem Erfolg sind oft mächtige, aber verschüttete Glaubenssätze im Weg. „Du kannst es nicht! Du bist zu schlecht! Du hast es nicht verdient!“ Der zentrale Glaubenssatz von Alexander Müller lautet dagegen: „It‘s in you!“ Wenn du es träumen kannst, kannst du es erreichen! In einer einzigartigen Mischung aus praktischen Ratschlägen und seinen inspirierenden eigenen Geschichten führt er seine Leser auf eine Reise der Selbstentdeckung, in der er die Schlüsselprinzipien benennt, die zu persönlichem und beruflichem Erfolg führen – und am Ende zu einer besseren Gesellschaft.
Alexander Müller Boeken






Mit der Umsetzung der Digitale-Inhalte-Richtlinie und der Warenkaufrichtlinie wurde in Österreich das Verbrauchergewährleistungsgesetz eingeführt und Bestimmungen des ABGB und KSchG abgeändert. Der Kurzkommentar bietet eine kompakte Übersicht über die Bestimmungen des VGG sowie deren Anwendung. Kompakte und übersichtliche Kommentierung des VGG Mit der Umsetzung der Digitale-Inhalte-Richtlinie und der Warenkaufrichtlinie wurde in Österreich das Verbrauchergewährleistungsgesetz (VGG) eingeführt und Bestimmungen des ABGB und KSchG abgeändert. In kompakter Form verschafft dieser Kurzkommentar eine Übersicht über die Bestimmungen des VGG sowie deren Anwendung. Die Autor:innen, die als Rechtsanwält:innen, in der Justiz, im universitären Bereich sowie in der Privatwirtschaft als Unternehmensjurist:innen tätig sind, haben ihre bisherigen Erfahrungen bei der Kommentierung eingebracht, um den Anwender:innen die Bestimmungen des VGG durch - an den notwendigen Stellen eingefügte - Praxisbeispiele näherzubringen. Darüber hinaus bietet der Kommentar einen Überblick über die bisher zum VGG veröffentlichte Literatur und ermöglicht somit, die gesetzlichen Bestimmungen in Zusammenschau mit den unionsrechtlichen Erwägungen sowie österreichischen Literaturmeinungen zu erfassen. Jetzt reinlesen: Inhaltsverzeichnis(pdf)
Mit der Umsetzung der Digitale-Inhalte-Richtlinie und der Warenkaufrichtlinie wurde in Österreich das Verbrauchergewährleistungsgesetz eingeführt und Bestimmungen des ABGB und KSchG abgeändert. Der Kurzkommentar bietet eine kompakte Übersicht über die Bestimmungen des VGG sowie deren Anwendung. Kompakte und übersichtliche Kommentierung des VGG Mit der Umsetzung der Digitale-Inhalte-Richtlinie und der Warenkaufrichtlinie wurde in Österreich das Verbrauchergewährleistungsgesetz (VGG) eingeführt und Bestimmungen des ABGB und KSchG abgeändert. In kompakter Form verschafft dieser Kurzkommentar eine Übersicht über die Bestimmungen des VGG sowie deren Anwendung. Die Autor:innen, die als Rechtsanwält:innen, in der Justiz, im universitären Bereich sowie in der Privatwirtschaft als Unternehmensjurist:innen tätig sind, haben ihre bisherigen Erfahrungen bei der Kommentierung eingebracht, um den Anwender:innen die Bestimmungen des VGG durch - an den notwendigen Stellen eingefügte - Praxisbeispiele näherzubringen. Darüber hinaus bietet der Kommentar einen Überblick über die bisher zum VGG veröffentlichte Literatur und ermöglicht somit, die gesetzlichen Bestimmungen in Zusammenschau mit den unionsrechtlichen Erwägungen sowie österreichischen Literaturmeinungen zu erfassen. Jetzt reinlesen: Inhaltsverzeichnis(pdf)
Der Weg zu einer besseren Welt führt über das Speaking. Redner wie Martin Luther King, Steve Jobs oder Greta Thunberg haben Mindsets verändert. Doch wie werden gute Ideen geboren? Warum haben (fast) alle etwas zu sagen? Und wie lässt sich Reichweite gewinnen? Alexander Müller und Stefan Frädrich, Macher des Europas führende Coaching- und Speakingplattform Greator, haben schon Hunderten geholfen, Speaker zu werden. In diesem Buch verraten sie ihr Erfolgskonzept. Und sie beschreiben den Weg ihres Unternehmens zu einem relevanten Player in der Weiterbildungsszene, auf dem sie trotz vieler Widrigkeiten wie festen Weltbildern und einer Pandemie immer für etwas gekämpft haben. Zuversichtlich, aufgeschlossen, wohlwollend. Es ist eine Haltung, die die Autoren in diesem Buch beschreiben – die alle brauchen, die die Welt mit ihren Gedanken zum Guten wenden wollen.
Die Seele lebt vom Sinn - bk1730; Horizonte Verlag; Alexander Müller & Erika Blumenthal; pocket_book; 1990
Digitale Fotografie für Fortgeschrittene
- 93bladzijden
- 4 uur lezen
Es gibt in der fortgeschrittenen Fotografie zahlreiche anspruchsvolle Motive, die darauf warten, festgehalten zu werden: Seien es die Blitze eines Gewitters, einzigartige Momente im Sport oder im Alltag, die nur bei wenigen tausendstel Sekunden Belichtungszeit wahrgenommen werden können oder die Stimmungen, die am Abend während des Sonnenuntergangs und der „Blauen Stunde“ geboten werden. Dieses A4-Skriptum soll Sie vor allem auf drei Ebenen weiterbringen: Hintergrundwissen zu fortgeschrittenen, technischen Einstellungen und Begriffen zu erlangen, sodass Sie diese grundlegend verstehen, dem Thema Licht die notwendige Aufmerksamkeit und Sensibilität zu schenken sowie durch konkrete Tipps und Anleitungen auch fotografisch anspruchsvolle Situationen meistern zu können. schwarz-weiß Ausgabe
Grundlagen der Individualpsychologie
- 206bladzijden
- 8 uur lezen