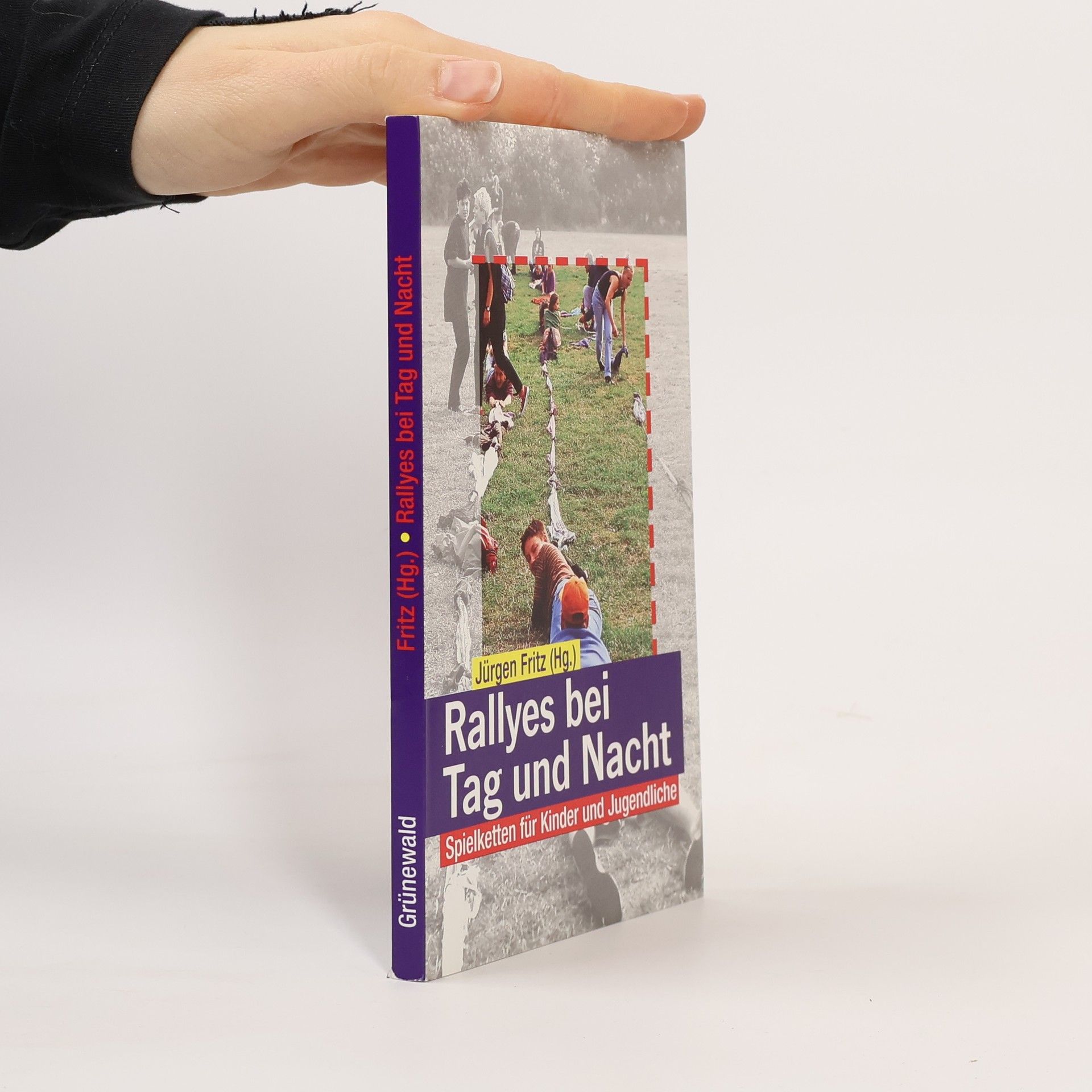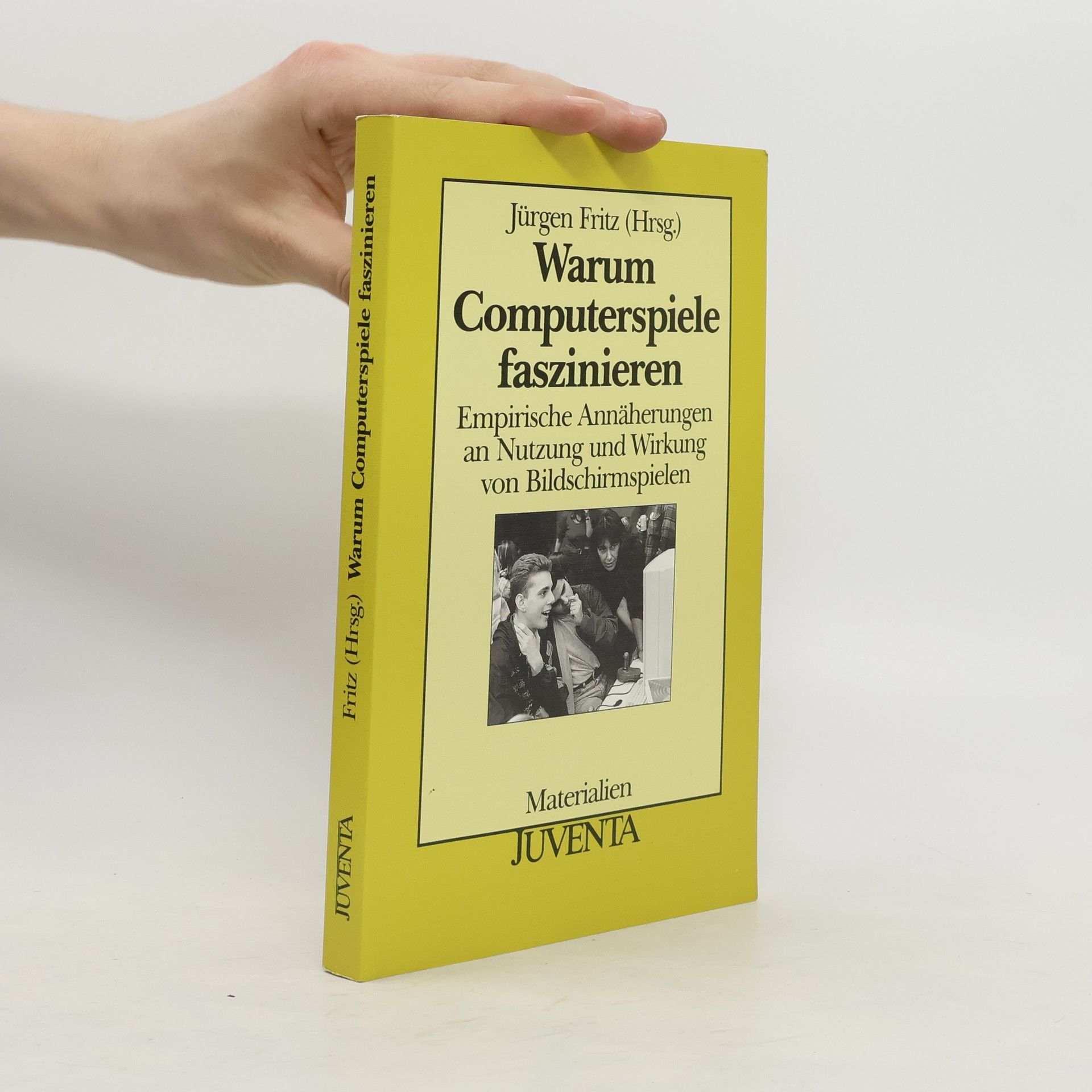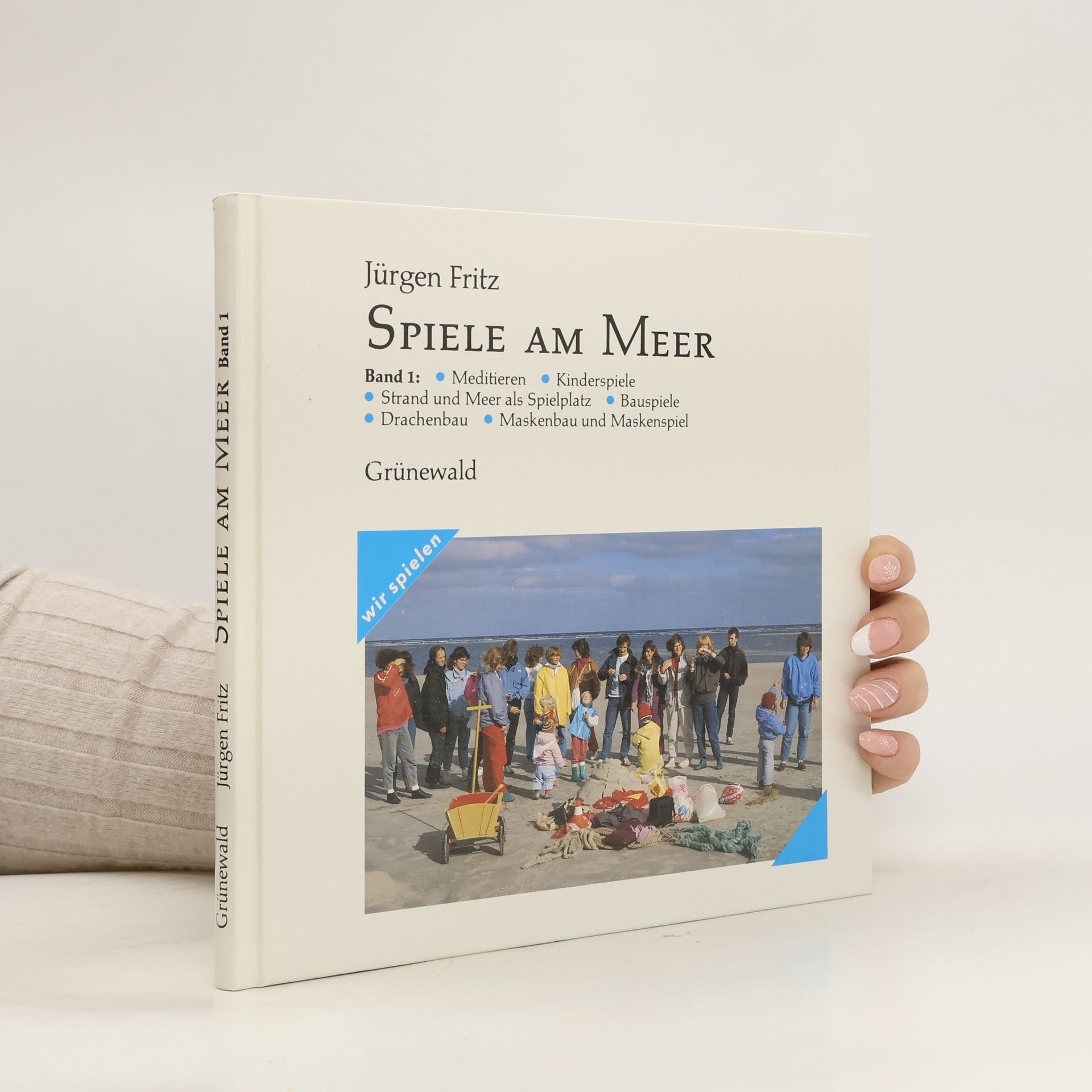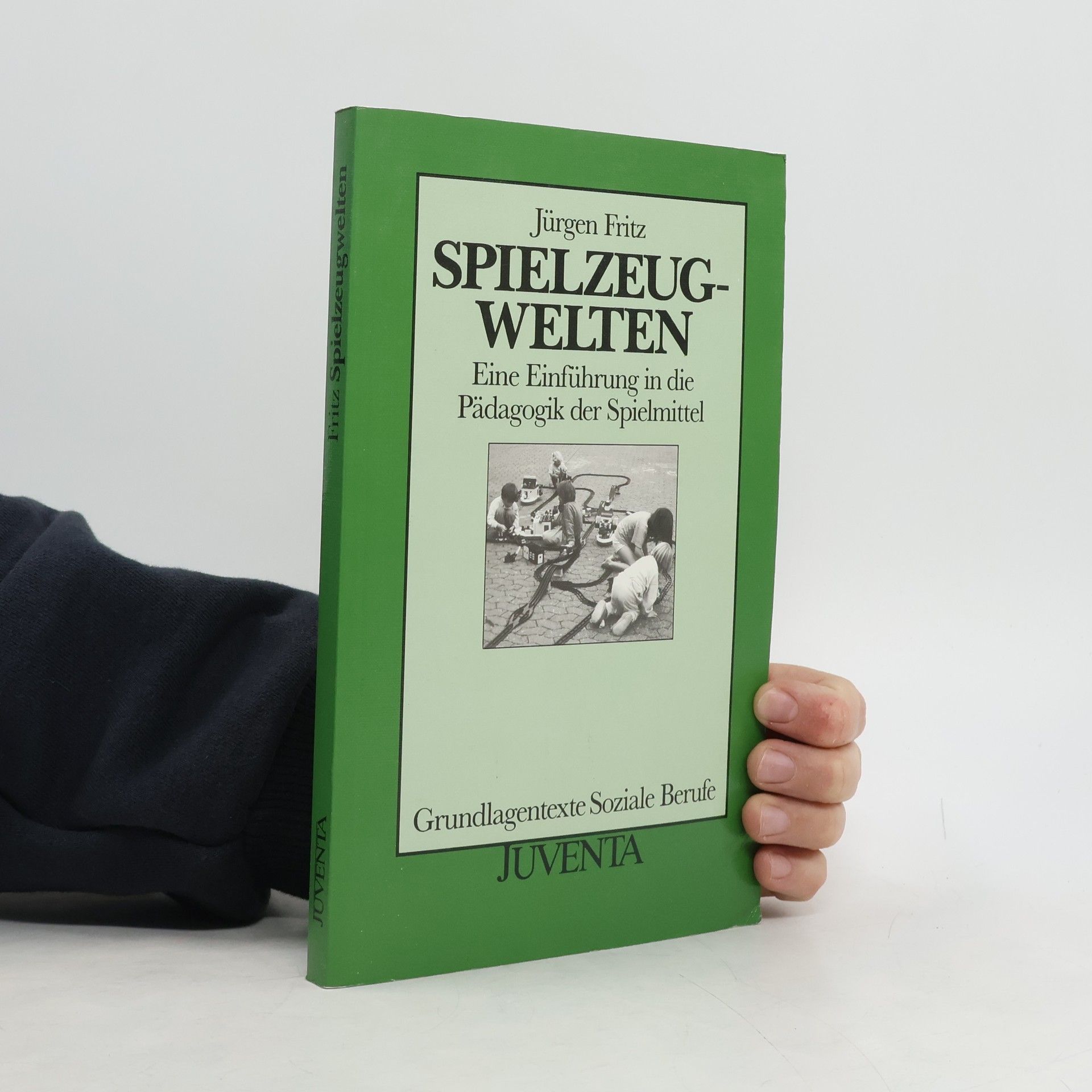Qualität neu denken
Innovative, virtuelle und agile Ansätze entlang der Wertschöpfungskette
- 516bladzijden
- 19 uur lezen
Entwicklungen, wie Urbanisierung, Internationalisierung, Klimakrise, Digitalisierung und COVID-19-Pandemie haben in Gesellschaft und Unternehmen zu einer näheren Betrachtung der Qualität von Produkten und Dienstleistungen in den global agierenden Wertschöpfungsketten geführt. Durch internationale Produktionsverbünde, Wertschöpfungsallianzen und Verlagerungen auf Lieferantennetzwerke, die im Wettbewerb zueinanderstehen, bilden sich neue Leitbilder, Strategien und Abläufe im Qualitätsverständnis. Das Buch beschreibt, wie ein agiles und nachhaltiges Qualitätsmanagement gestaltet werden kann und gibt anhand zahlreicher Beispiele, Fallstudien und Arbeitshilfen wertvolle Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Transformation. Inhaltsverzeichnis Qualitätsmanagement im Überblick.- Innovationstreiber und Neuheiten im Qualitätsmanagement.- Qualitätsmanagement in verschiedenen Unternehmensbereichen.- Ansätze, Methoden und Werkzeuge im Qualitätsmanagement.- Qualitätsmanagement der Zukunft.