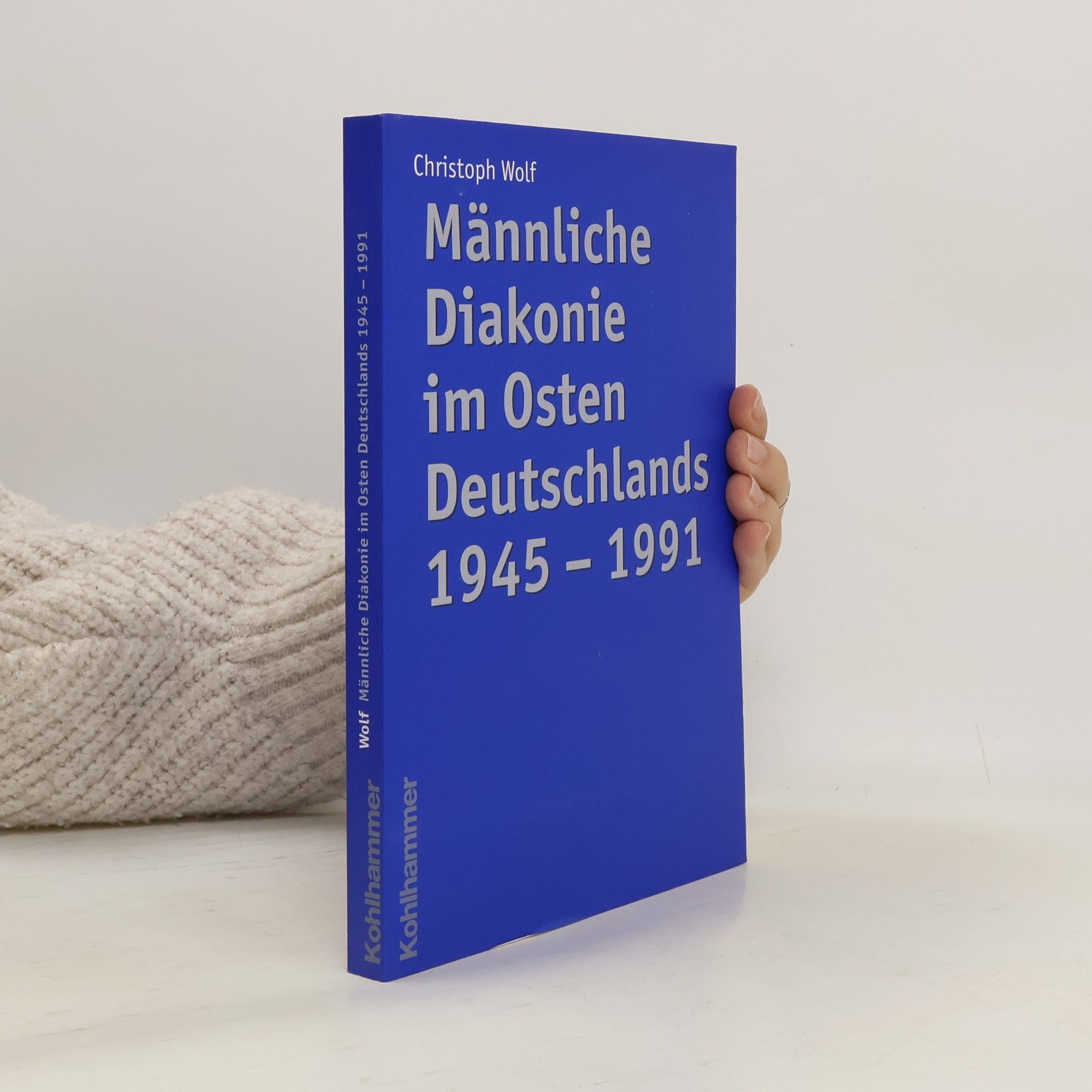Wie Politiklehrkräfte Antisemitismus denken
Vorstellungen, Erfahrungen, Praxen
- 328bladzijden
- 12 uur lezen
Die Studie untersucht, wie Politiklehrkräfte Antisemitismus wahrnehmen und verarbeiten. Dabei stehen ihre subjektiven Vorstellungen sowie schulischen Erfahrungen im Fokus. Die Analyse zeigt, dass trotz einer grundsätzlich anti-antisemitischen Haltung der Lehrkräfte antisemitische Denkmuster oft reproduziert oder im Schulalltag übersehen werden. Die Ergebnisse bieten wertvolle Einblicke, um Fortbildungsangebote nachhaltig und subjektorientiert zu gestalten, um dem Antisemitismus im Bildungskontext effektiver entgegenzuwirken.