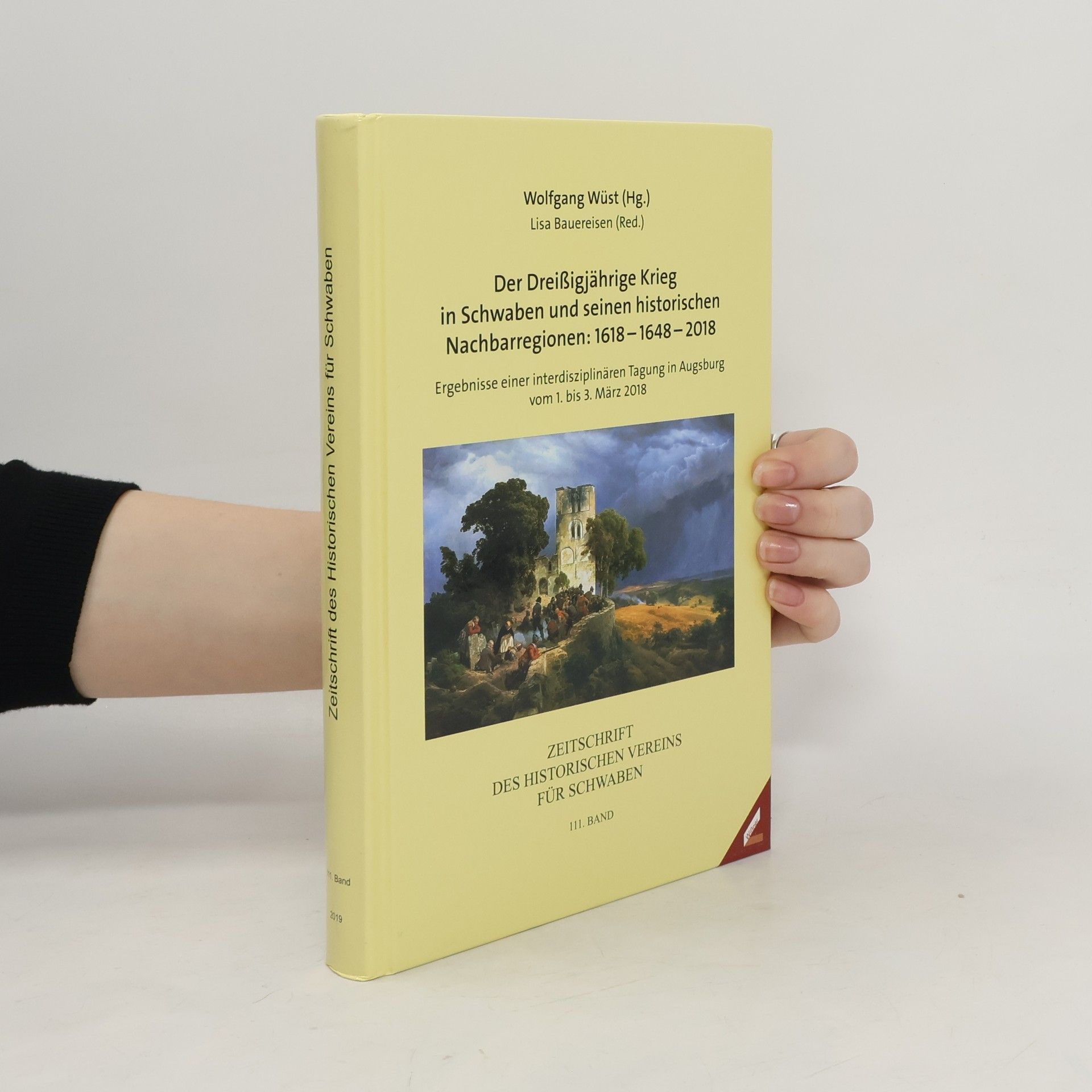Wolfgang Wüst Boeken
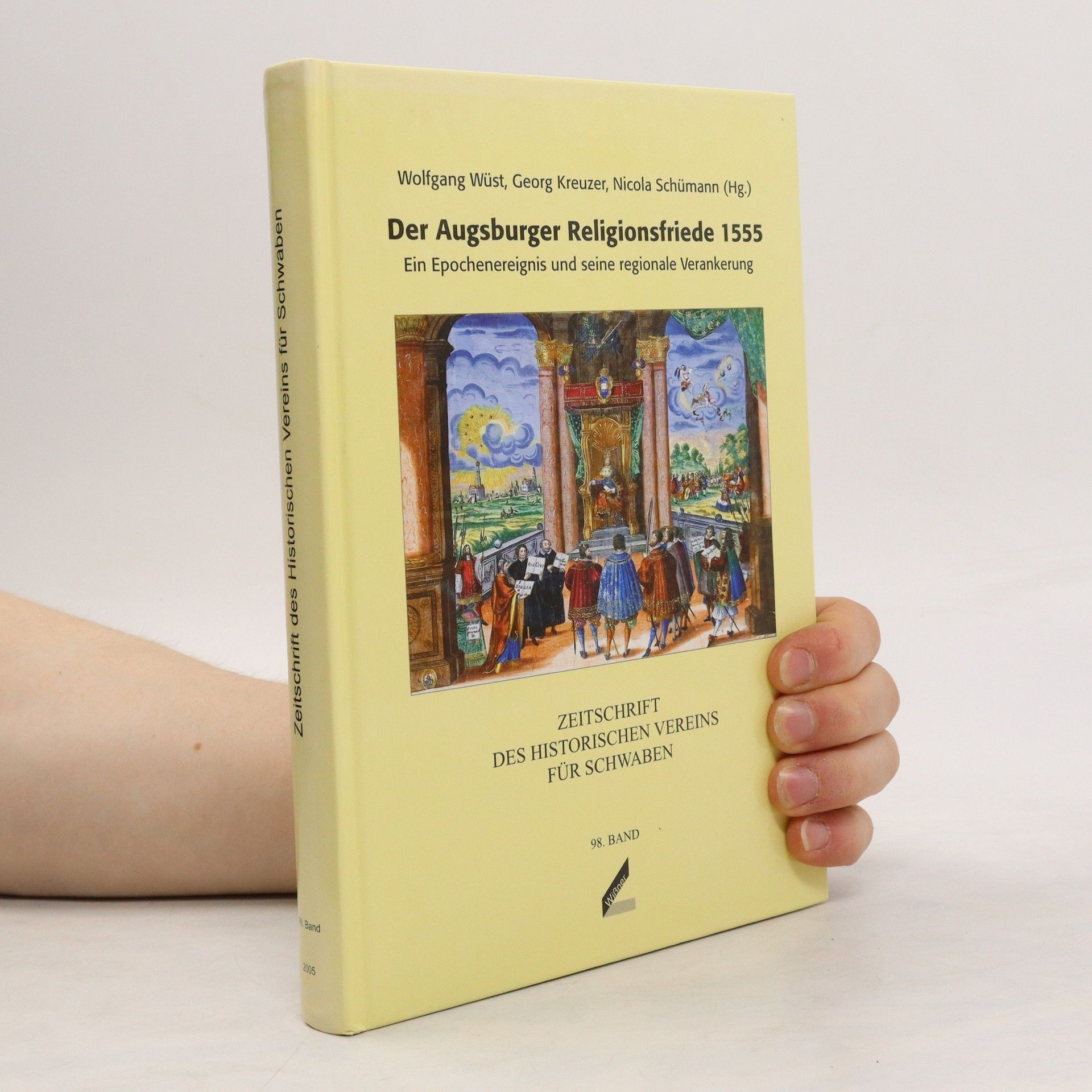



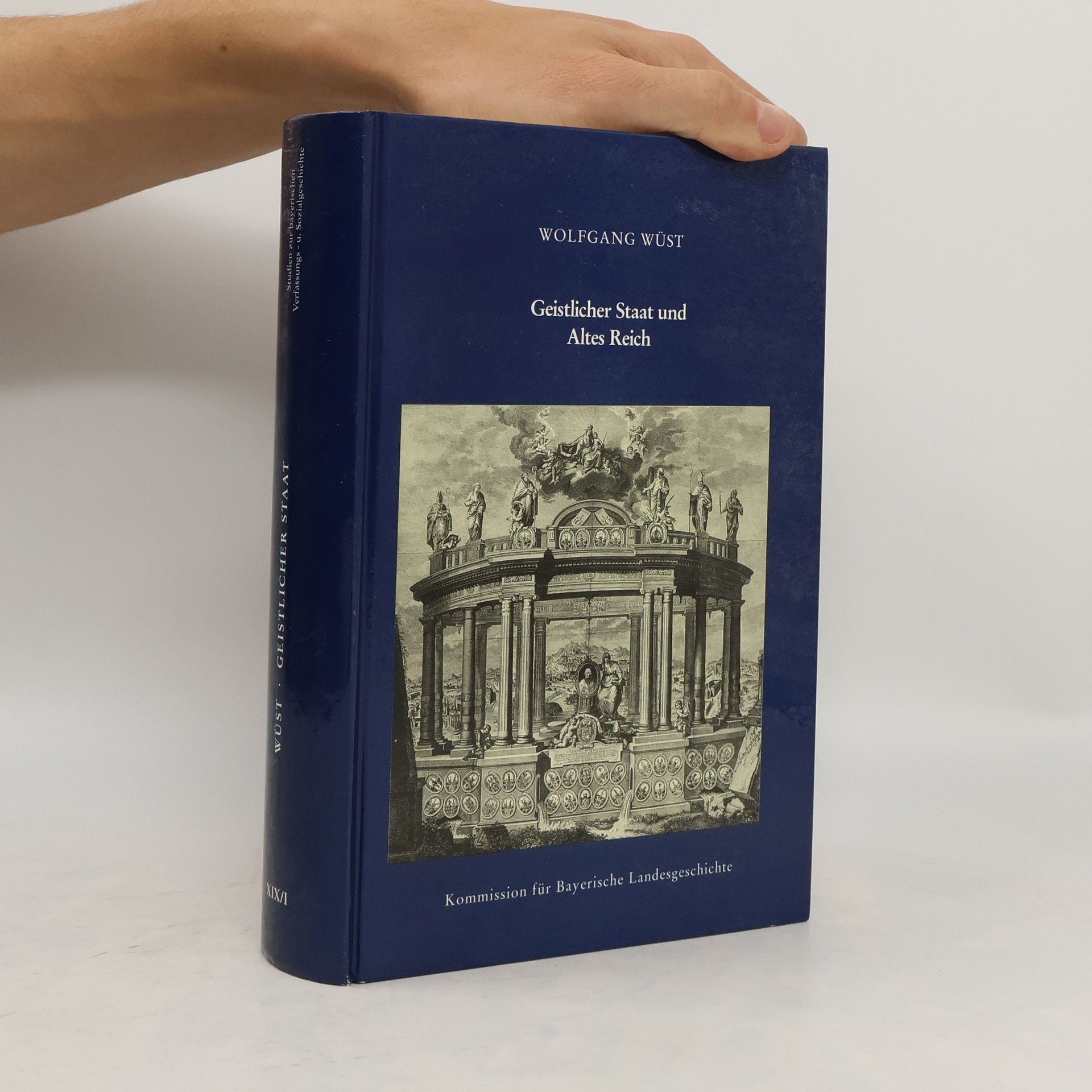
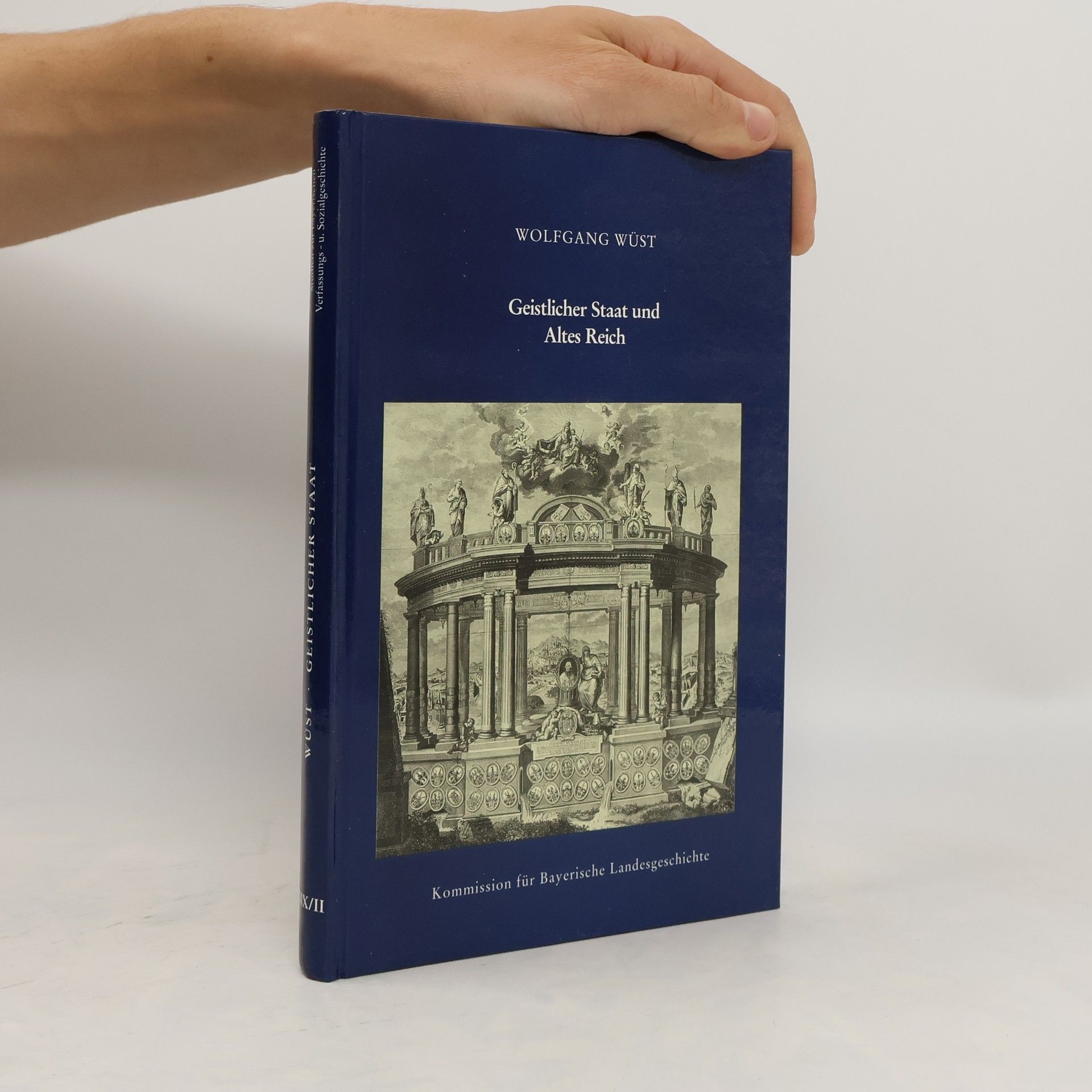
Frankens Policey
Alltag, Recht und Ordnung in der Frühen Neuzeit
Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und seinen Regionen - die „Franconia" präsentiert sich unter einem Brennglas herausgehoben - setzten Institutionen und Kanzleien, Räte und Regierende auf eine in der Antike entworfene, im Mittelalter geborene und in der Frühen Neuzeit ausgereifte Form zur Vermittlung allgemeiner Wertmaßstäbe. Diese Gesetzgebung war - trotz Scheidung in spezielle bis allgemeine, Orte und Personen konkret oder pauschal berührende Materien - vor der Nationenbildung des 19. Jahrhunderts umfassend angelegt. Als „gute" Policey - im Unterschied zur heutigen Polizei als staatlichem Vollzugsorgan - gliederte sie sich in „ordinationes speciales" (Kleider- und Luxusordnungen; Kirchen- und Sonntagsschutz; Bier-, Wein- und Branntweingebote; Jagd-, Bau-, Markt-, Wirtshaus-, Gesundheits-, Trauer- oder Ehevorschriften; Glücksspiel- und Lottoverbote usw.), „imperiales" (Länder- und Reichsordnungen) und „provinciales" (Gebiets-, Städte-, Markt-, Wald- und Dorfordnungen)
Die gesammelten Beiträge zur Tagung des Historischen Vereins in Irsee, März 2005, behandeln den Augsburger Religionsfrieden und seine weitreichenden Auswirkungen. Axel Gotthard beleuchtet den Frieden als einen Meilenstein der frühneuzeitlichen Geschichte, während Peter Claus Hartmann den Reichstag von 1555 als entscheidenden Moment für die Kompetenzerweiterung der Reichskreise analysiert. Wolfgang E. J. Weber thematisiert den Reichsabschied von 1555 im Kommunikationsgefüge des Reiches. Helmut Baier betrachtet den Frieden aus christlicher Perspektive, und Manfred Weitlauff untersucht die Folgen für die Reichskirche. Weitere Beiträge befassen sich mit dem Nebeneinander der Konfessionen nach 1555, illustriert durch Reiseberichte aus Bayerisch Schwaben, sowie der Debatte im Schwäbischen Kreiskonvent zwischen 1559 und 1562. Karl Härter diskutiert die Themen Religion, Frieden und Sicherheit als Aspekte guter Ordnung. Wolfgang Wüst analysiert die Rolle Augsburgs um 1555, während Hans Eugen Specker und Franz-Rasso Böck die Reichsstädte Ulm und Kempten im Kontext des Religionsfriedens betrachten. Zusätzlich werden die Auswirkungen auf die ostschwäbischen Reichsstifte und die Augsburger Klöster thematisiert. Beiträge zu den protestantischen Bewegungen in Hohenaschau und Wildenwart sowie zur Rolle der Fränkischen Hohenzollern runden die Sammlung ab. Abschließend wird die konfessionspolitische Debatte über den Augsburger Religionsfrie
Der Band veranschaulicht und interpretiert mit Beispielen aus über zwanzig Territorien eines in der zentralen Gesetzgebung sehr aktiven Reichskreises typische und bisweilen auch untypische Kennzeichen frühmoderner „Ordnungspolitik“ und eröffnet erstmals mit edierten Quellen einen systematischen Blick, wie die Reichsgesetzgebung auf die Statuten territorialer und städtischer Policey wirkte.
Mein Sturz in den Abgrund
... und wie ich auf wundersame Weise zur Leichtigkeit fand
Mitten in meiner erfolgreichsten und unbeschwertesten Lebensphase traf ich eine derart fatale Entscheidung, dass mich deren Auswirkung in eine tiefe Krise zwang. Die Folge war mein kompletter Ruin, nicht nur finanziell, sondern auch psychisch. Doch war das nicht mein endgültiges Scheitern, sondern im Gegenteil der Beginn einer bemerkenswerten Neuausrichtung meines Lebens. Lass dich mitnehmen auf meine dramatische wie staunenswerte Lebensreise, in deren Mittelpunkt die kaum noch erhoffte Wandlung meines zuweilen als Höllentrip erlebten Schicksals steht. Ich gewähre dir intime Einblicke in die Einsichten, Wege und in die geheimnisvolle Lenkung, mittels derer ich das Desaster überwand.
Der Dreißigjährige Krieg ist wie kaum ein anderer europäischer Konflikt – vielleicht abgesehen von den beiden Weltkriegen im 20. Jahrhundert – im allgemeinen Geschichtsbewusstsein präsent. Die Erinnerungen an diese für viele Regionen traumatischen Kriegserlebnisse sind vielerorts noch immer lebendig und tief im Bewusstsein verankert. Auch in der Geschichtswissenschaft sind Studien zu verschiedensten Aspekten dieses europaweiten, sowohl politischen als auch religiös-konfessionellen Konflikts mit seinen langfristigen Nachwirkungen, die unter anderem auch Kultur und Ökonomie betreffen, nach wie vor aktuell. Im Jahr 2018 jährt sich der Beginn des Dreißigjährigen Krieges zum 400. Mal. Das »Jubiläum«, das auch den Westfälischen Frieden von 1648 mit einschließt, war der Anlass für die Tagung »Der Dreißigjährige Krieg in Schwaben und seinen historischen Nachbarregionen 1618–1648–2018« mit neuen Forschungsperspektiven zu vielfältigen Themenbereichen des »Großen Krieges« wie dem Alltag während des Krieges in Klöstern und Stiften sowie in Reichs-, Residenz- und Universitätsstädten, aber auch mit Kriegserfahrungen im Spiegel der Literatur und Kunst sowie mit Situationen und Möglichkeiten des Reichsadels in dieser Krisenzeit. Der vorliegende Band enthält nun in der Drucklegung die Beiträge dieser internationalen und interdisziplinären Tagung, die im Akademischen Forum des Hauses Sankt Ulrich in Augsburg vom 1. bis 3. März 2018 stattfand.
This collection features contributions from a conference organized by the Historical Association for Swabia in Irsee, November 2007. It includes various studies on early modern political theory in Bavarian Swabia, territorial conflicts and resolutions in the 16th century, and the role of spiritual estates in the Germania Sacra. The volume examines France's influence on Swabia, the international relations of the Carthusian Order in the Middle Ages, and the complexities between the Swabian province of the Pauline Order and its leadership in Hungary. It also discusses the historical context of St. Ulrich in the Regensburg diocese, the rivalry between Wittelsbach-Bavaria and Habsburg-Austria over the Augsburg bishopric in 1740, and the personal crossing of boundaries by Bishop Josef of Augsburg. Additional topics include the cultural interplay between Augsburg and Munich, the Augsburg pastor Samuel Urlsperger's role in the Georgia settlement project, and the impact of Maximilian I and Albrecht IV on relations with the Turks. The collection further explores the historical connections between southern Germans and Paris, the role of southern imperial cities as information hubs, and the educational reforms by humanists in the region. It concludes with analyses of Augsburg's newspaper's perception by European powers and the significance of Swabia in Habsburg imperial politics.