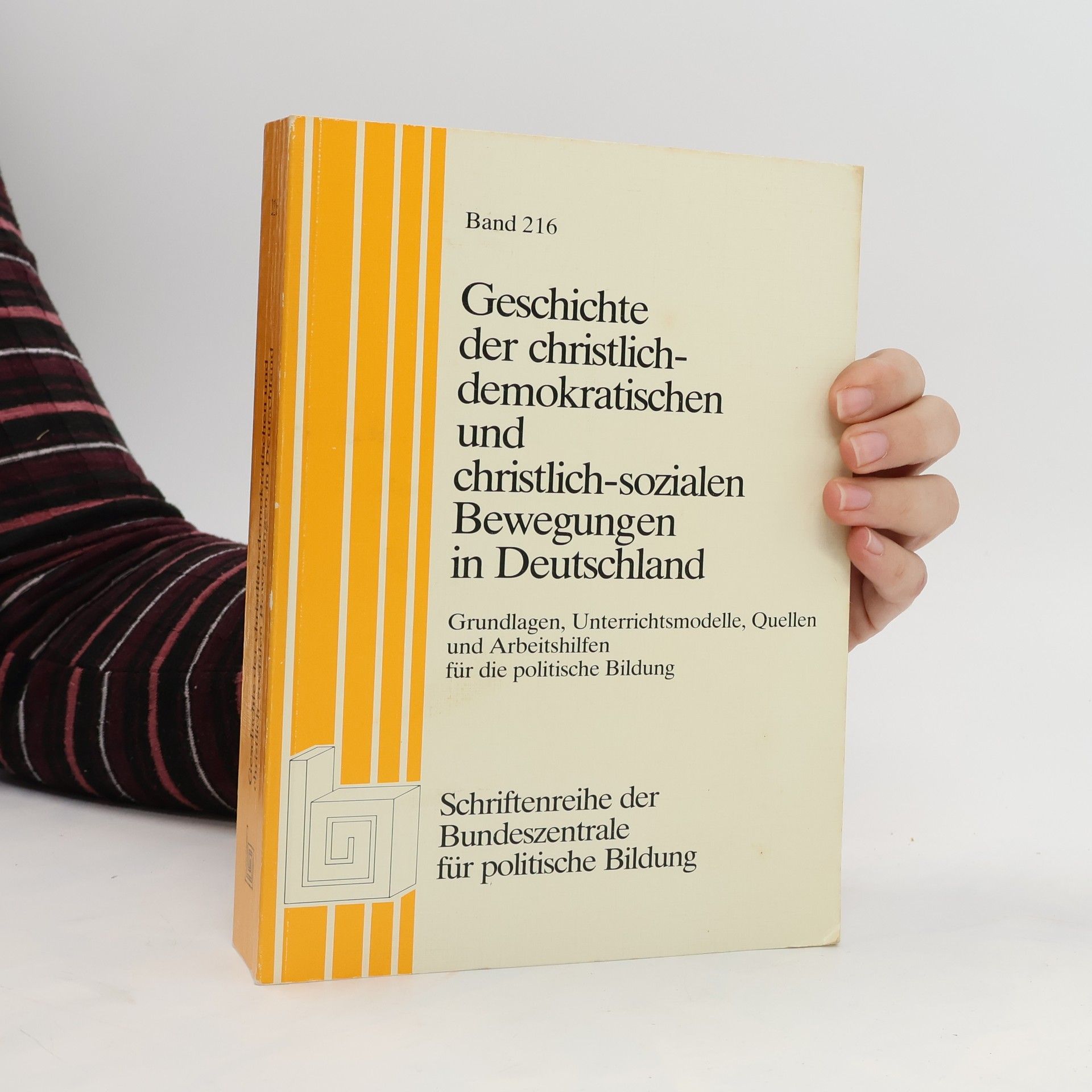Heinrich Mann, ein bedeutender deutscher Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, steht im Schatten seines Bruders Thomas und der deutschen Teilung. Während er in der DDR geschätzt, aber politisch missbraucht wurde, fand er in der BRD lange keine Anerkennung. Diese Biografie beleuchtet sein aktuelles Werk und seinen radikalen Idealismus.
Günther Rüther Boeken
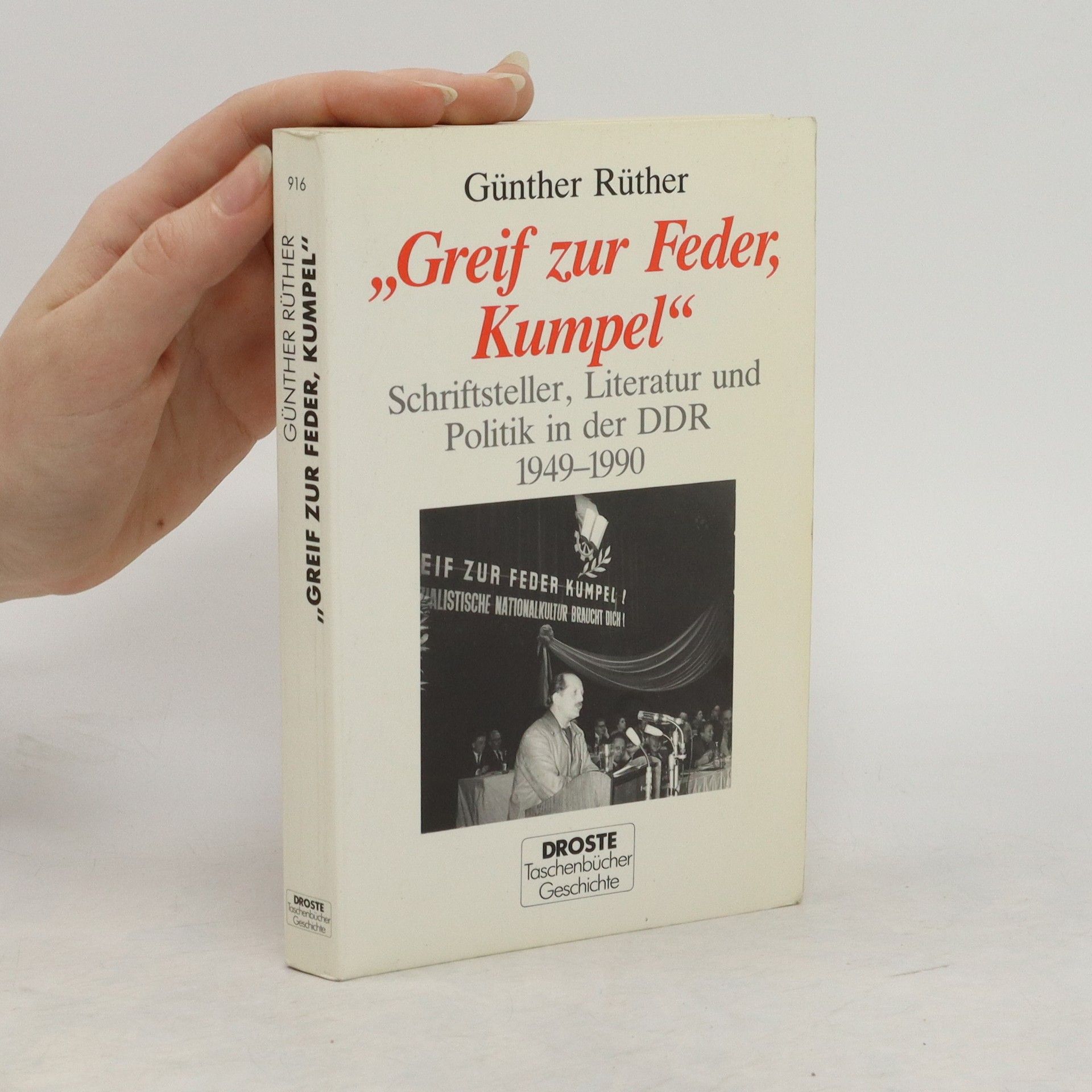
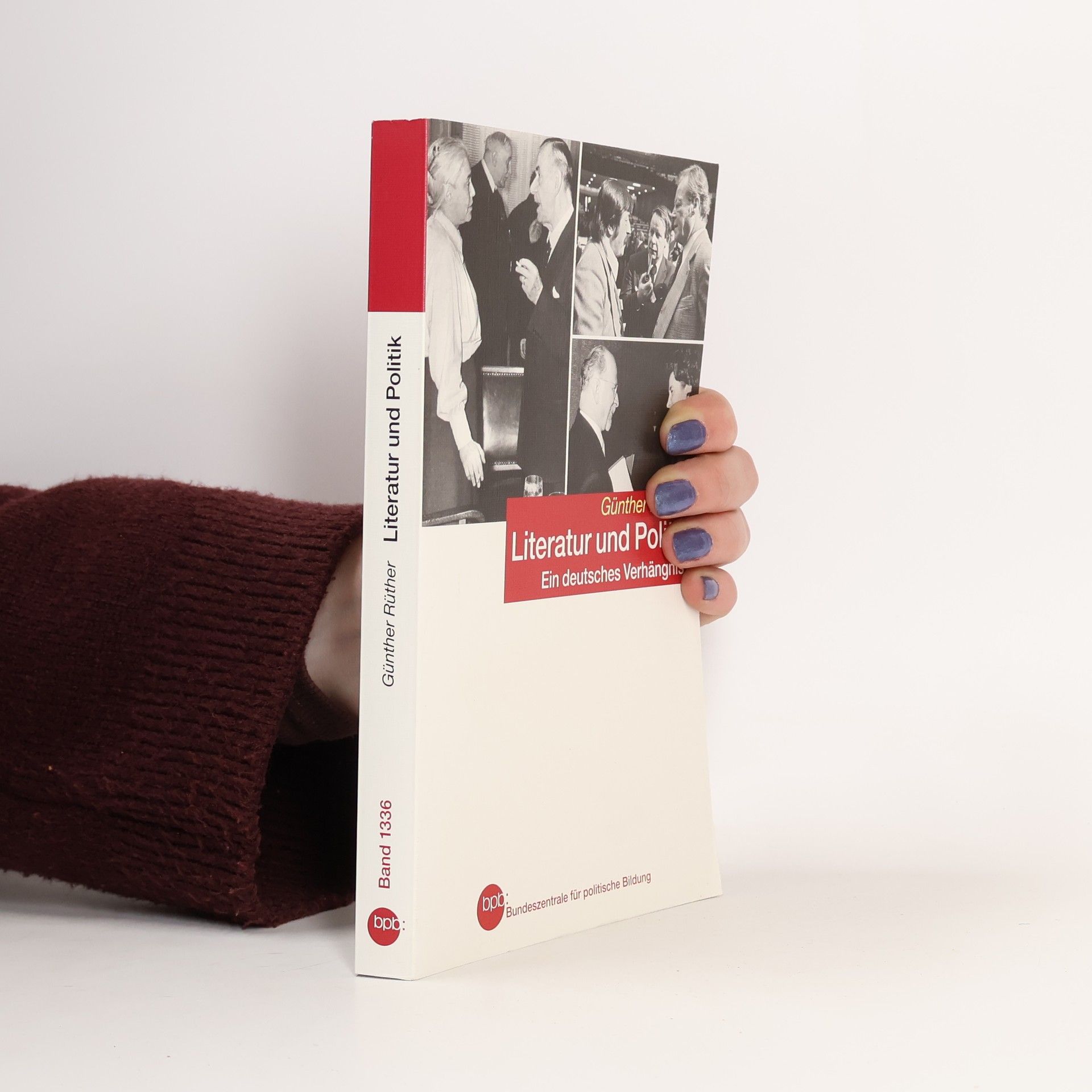
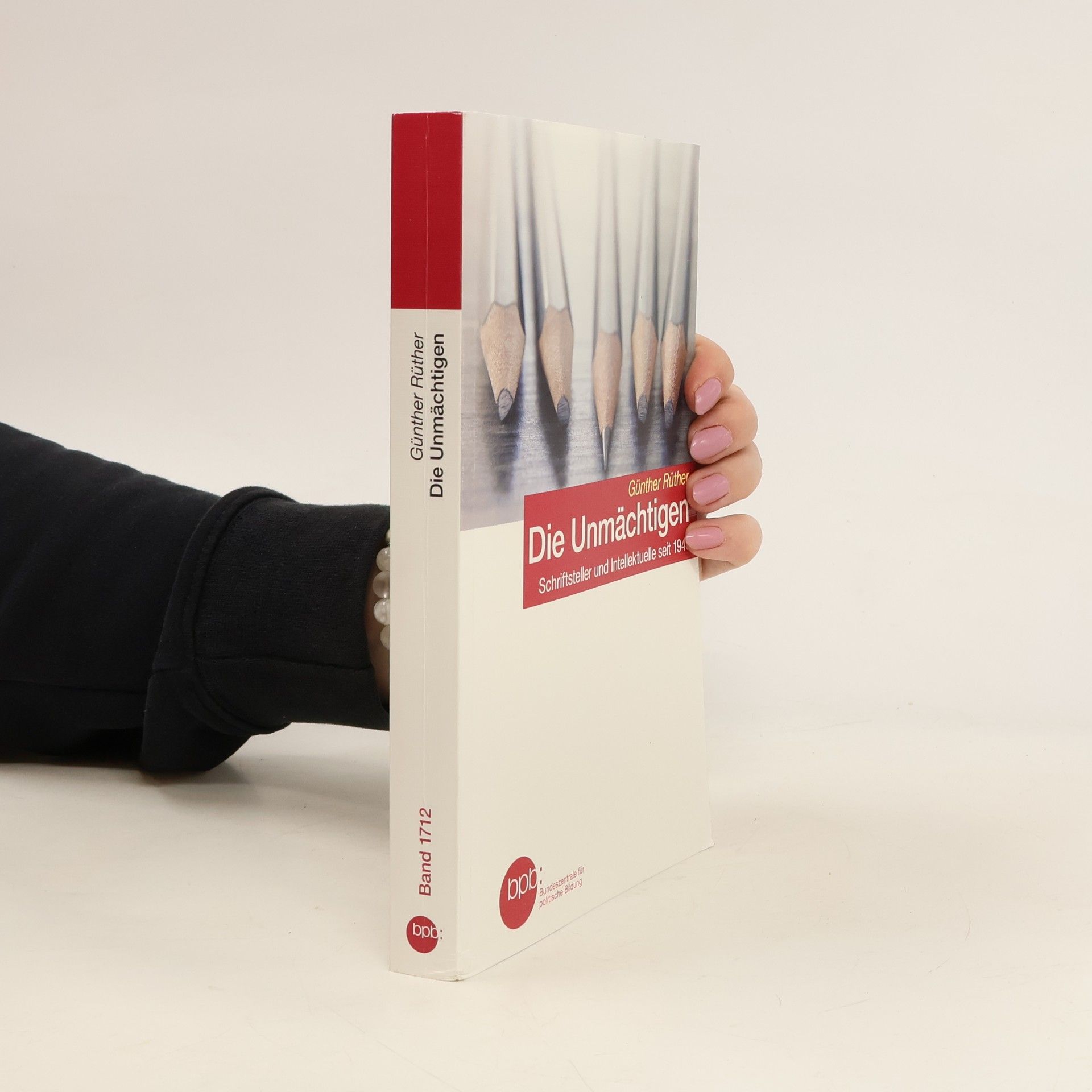
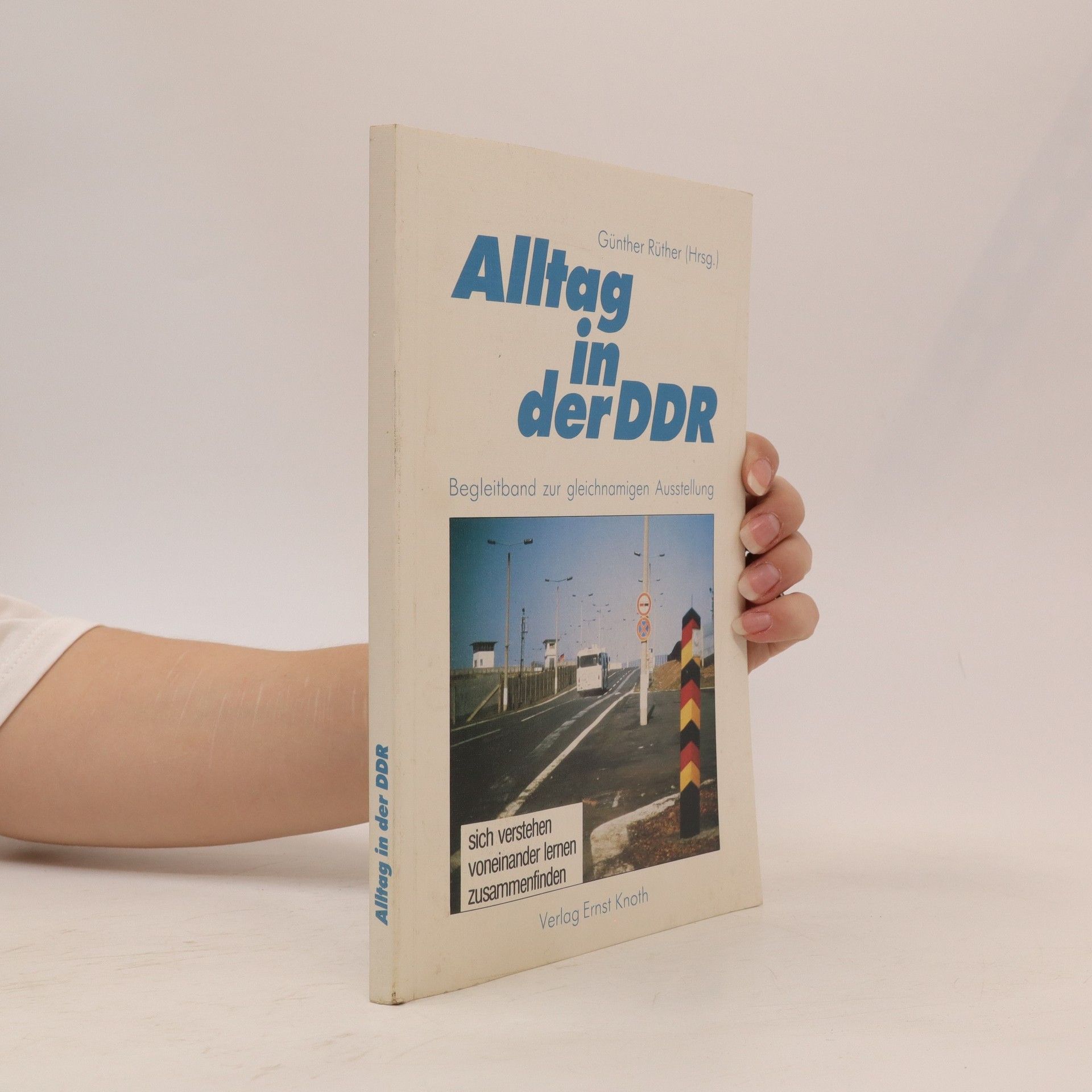


Günter Grass
Ein politischer Märchenerzähler und Provokateur / Biografie
"Schriftsteller, Nobelpreisträger und genialer Erzähler: Als eine der bedeutendsten Stimmen der Literatur im 20. Jh. und darüber hinaus nimmt Günter Grass eine Ausnahmestellung in der deutschen Literatur ein. Er galt als unbequeme Stimme, als Stimme der Unabhängigkeit und Rücksichtslosigkeit, auch gegen sich selbst. Ein Aufrüttler, ein Infragesteller, ein Provokateur, einer, der ab und zu auch gerne Märchen erzählt, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Günther Rüther stellt den genialen Erzähler in das Urteil seiner Zeit und macht deutlich, dass seine Bücher und Zeichnungen heute noch leben. Sie fördern das Nachdenken und den Widerspruch. Sie zeigen auf, dass die Wirklichkeit komplexer ist, als wir sie uns ausmalen. Sie zerstören Mystifizierungen, klären auf, provozieren, und beflügeln gleichzeitig die Fantasie. Ein Märchenerzähler und Provokateur, der seine Leser zu fesseln weiß, sie aus dem Alltag heraus in ungeübte Höhen der Fantasie emporjagt, und unserer heutigen Kultur bitter fehlt."
"Eine Verèoffentlichung des Instituts fèur Politische Bildung der Konrad-Adenauer-Stiftung"--P. facing t.p. Includes bibliographical references (p. 157-160)
Die Unmächtigen sind Intellektuelle und Schriftsteller, die sich in die gesellschaftlichen und politischen Diskurse einmischen und der Macht widersprechen, obwohl sie keine politischen Mittel besitzen. Ihre Bühne ist die Öffentlichkeit, wo sie mit der Kraft ihrer Worte agieren. Die Gesellschaft benötigt ihre oft abenteuerlichen Einsichten ebenso wie die Politik, die von Kompromiss und Pragmatismus geprägt ist. Günther Rüther erzählt die spannende Geschichte von Geist und Macht in beiden Teilen Deutschlands vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Gegenwart. Zentrale Figuren sind Günter Grass, Jürgen Habermas, Stefan Heym und Christa Wolf. Rüther zeigt den Einfluss der Unmächtigen und die Reaktionen der Mächtigen, wobei es um die Freiheit des Wortes, verschiedene Gesellschaftsmodelle, Mehrheiten, Polemiken, Einfluss und Macht sowie persönliche Empfindungen geht. Die Darstellung reicht bis in die Gegenwart, wo ein "Ende des Intellektuellen" konstatiert wird, der nur als Visionär für das Projekt Europa fungiert. Das Buch weckt starkes Interesse für seinen faszinierenden Gegenstand, wird jedoch durch parteiideologische Interessen kritisch betrachtet. Rüthers Erzählung neigt dazu, eine Siegergeschichte zu präsentieren, die das bereits Bekannte umschreibt.
Die Studie beschreibt und deutet das Verhältnis von Literatur und Politik in Deutschland. Das Verhältnis von Geist und Macht war in Deutschland von vielen wechselseitigen Missverständnissen und falschen Erwartungen bestimmt. Die politische Macht versuchte oft, Einfluss auf die Künste zu nehmen, insbesondere auf die Literatur. Die Schriftsteller näherten sich häufig der Macht an, da sie sich Vorteile davon versprachen. Nur wenige Autoren aber setzten sich in der Diktatur kritisch mit der Macht auseinander, und auch in der Demokratie standen Schriftsteller lange Zeit abseits des politischen Diskurses. Günther Rüthers Leitfrage ist daher: Wurde das Verhältnis von Geist und Macht den Deutschen zum Verhängnis? Im ersten Teil der Untersuchung wird Thomas Mann behandelt, der gleichermaßen in der wilhelminischen Kaiserzeit, in der Weimarer Republik, während des Nationalsozialismus im Exil wie auch während der jungen Bundesrepublik geschrieben hat. Der zweite Teil konzentriert sich auf das Schreiben in der Diktatur, der dritte analysiert die unterschiedlichen Situationen im geteilten Deutschland.