Christoph König Boeken
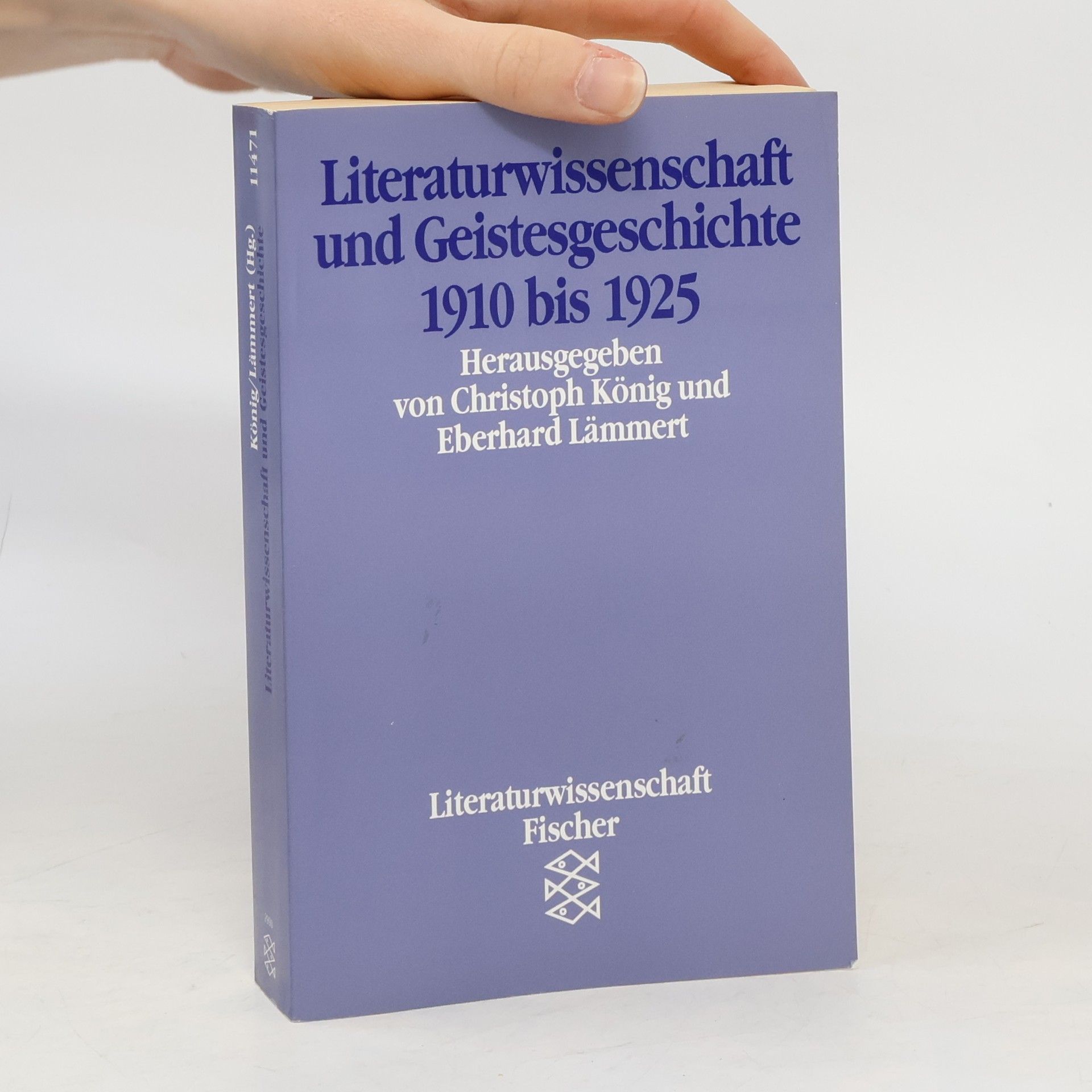
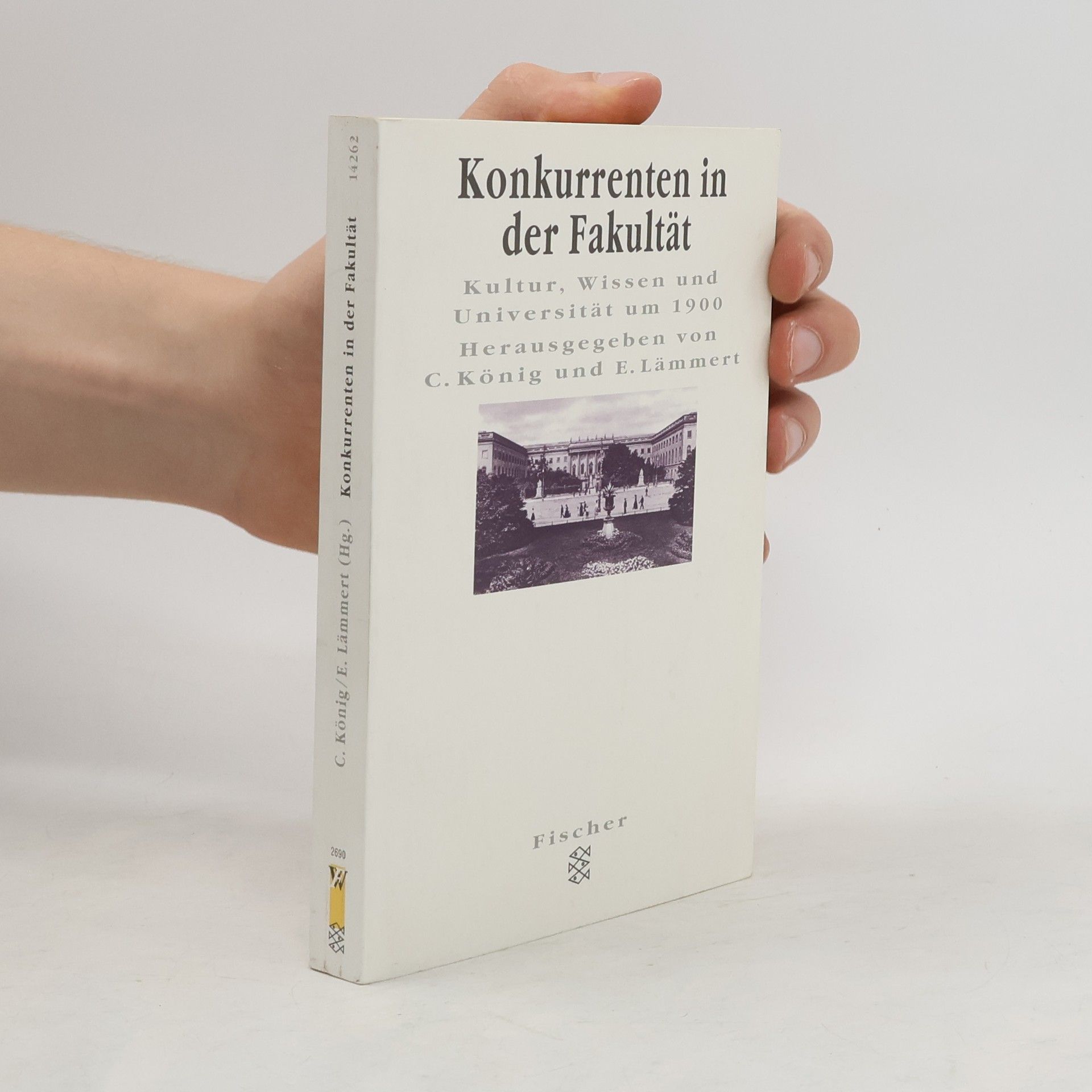

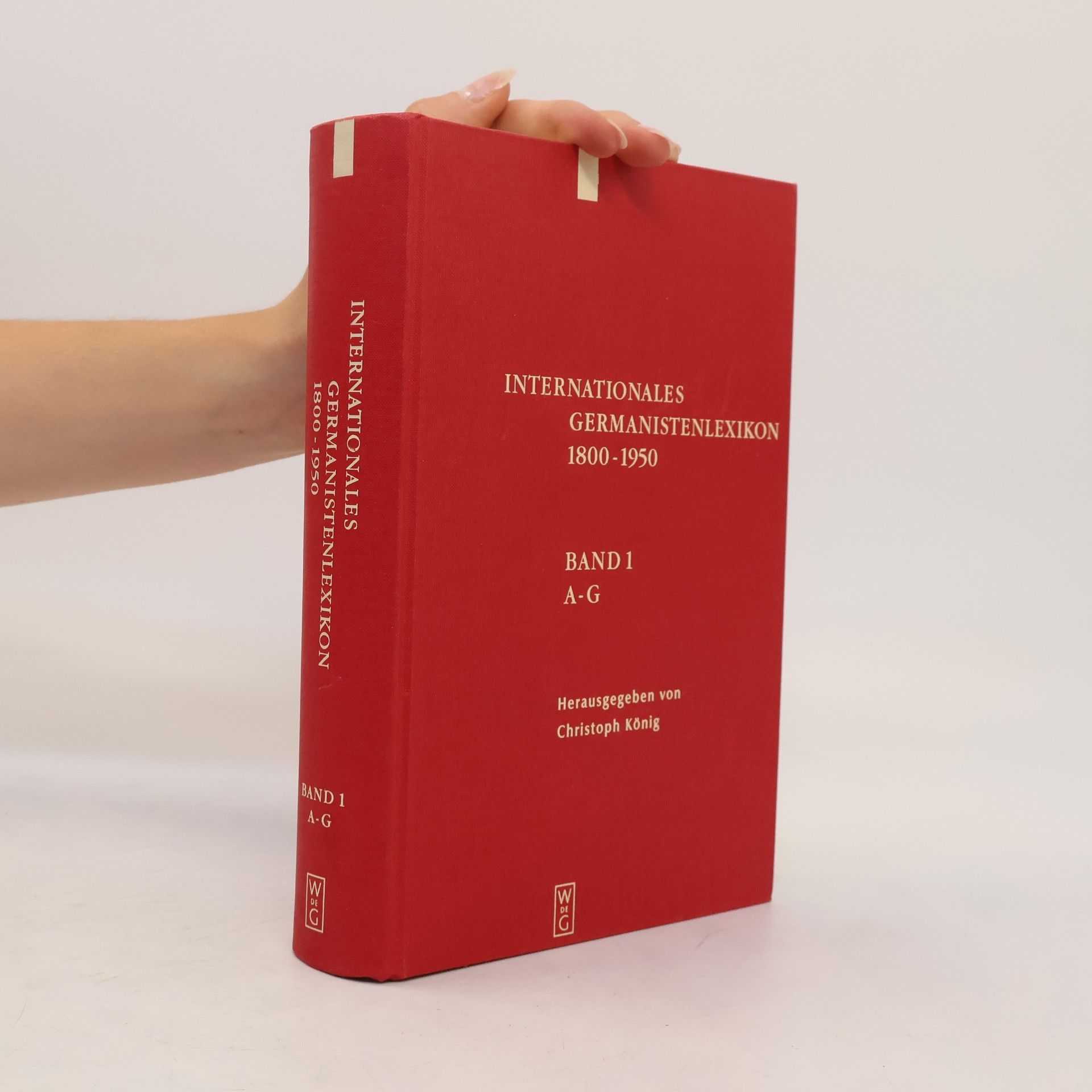
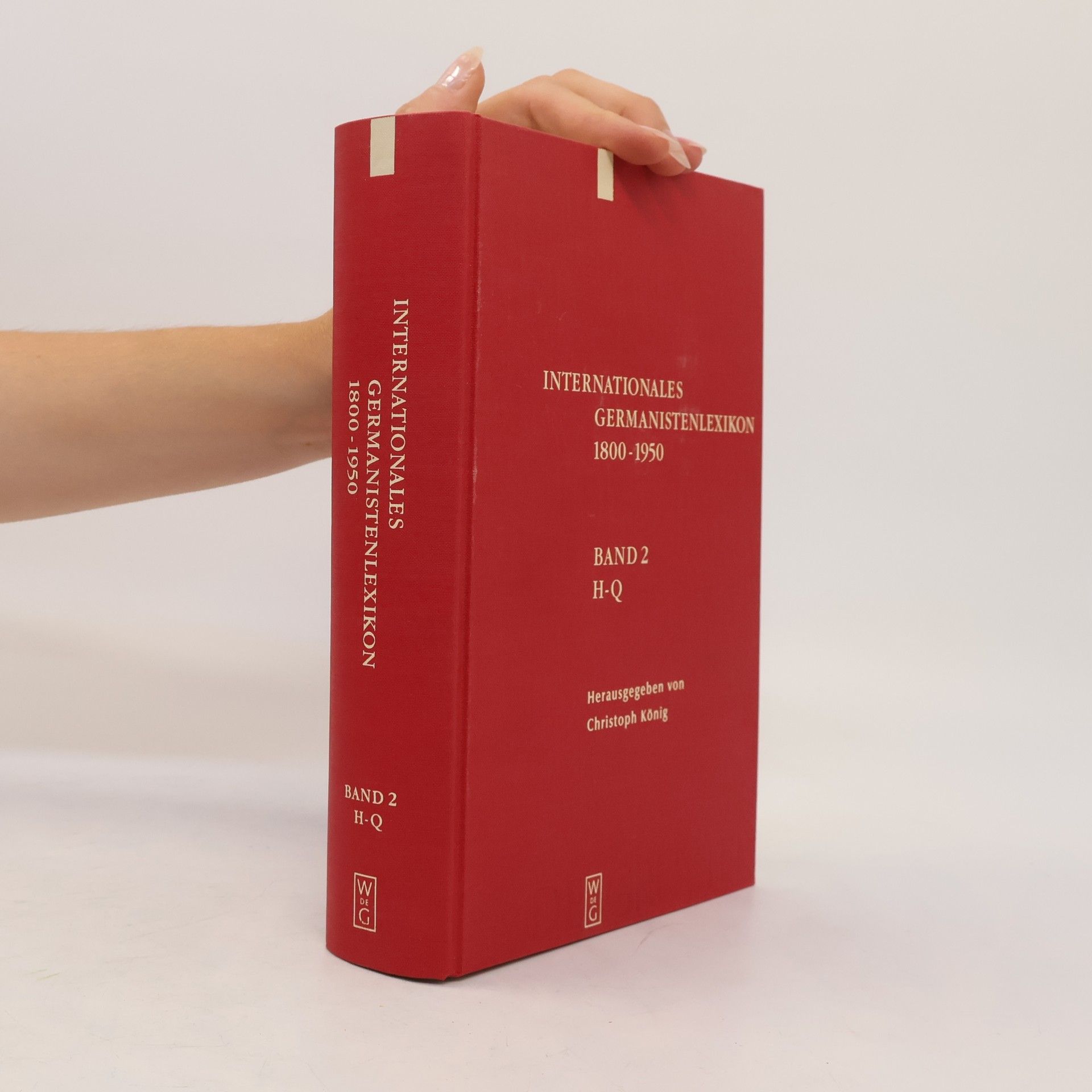
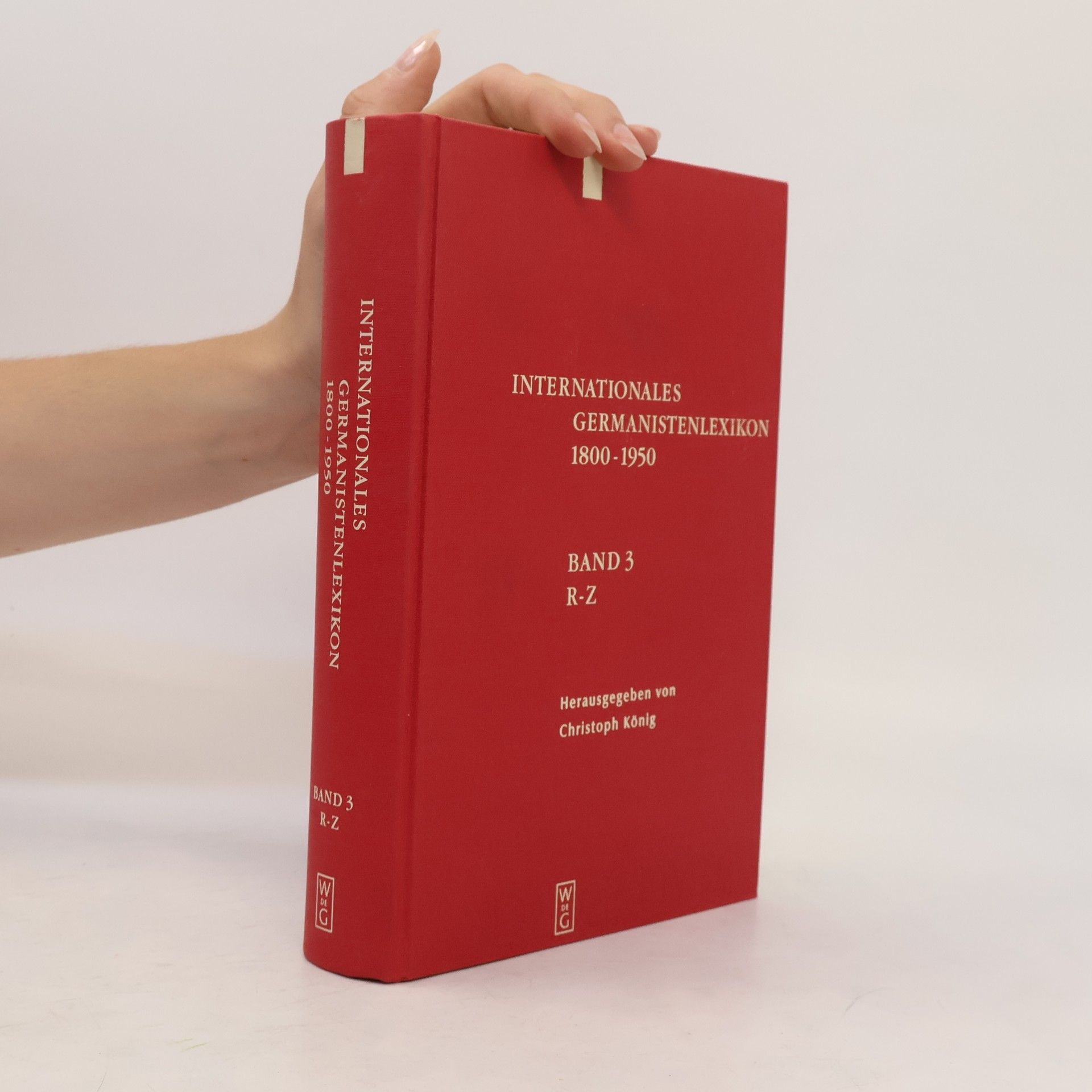
Internationales Germanistenlexikon 1800-1950. Band 1:, A-G
1500 Germanistinnen/Germanisten 44 Ländern
Die Germanistik blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück. Als Wissenschaft der deutschen Sprache und Literatur entstand sie im 19. Jahrhundert, mit namhaften Vertretern wie Jacob Grimm, Karl Lachmann und Wilhelm Wackernagel. Durch ihre Verbindung zu anderen Philologien und Kulturwissenschaften ist sie ein Teil der Geistesgeschichte. Das *Internationale Germanistenlexikon*, entwickelt am Deutschen Literaturarchiv Marbach, bietet umfassende Informationen zu 1500 bedeutenden Germanisten zwischen 1800 und 1950. Es ist ein grundlegendes Nachschlagewerk für Fachhistoriker und Literaturwissenschaftler und versammelt erstmals alle bio-bibliographischen Daten systematisch. Das Material wurde aus schwer zugänglichen Quellen und Nachlässen gewonnen. Jeder Artikel enthält Lebensdaten, akademische Laufbahn, Ehrungen, Mitgliedschaften sowie eine umfassende Bibliographie und Nachlasshinweise. Das Lexikon ist durch Indizes erschlossen, die gezielte Recherchen ermöglichen. Es ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Analyse der deutschen Philologie und ihrer Protagonisten. Hinweise, Korrekturen und Ergänzungen werden in der Zeitschrift *Geschichte der Germanistik. Mitteilungen* veröffentlicht.
Zweite Autorschaft
Philologie, Poesie und Philosophie in Friedrich Nietzsches »Also sprach Zarathustra« und »Dionysos-Dithyramben«
- 327bladzijden
- 12 uur lezen
Insistierende Lektüren und Forschungskritik - nach Maßgabe der kreativen Praxis in Nietzsches späten Werken. Friedrich Nietzsches Prosawerk "Also sprach Zarathustra" und der späte Gedichtzyklus "Dionysos-Dithyramben" (1889) sind in der Ausdrucksweise poetisch, verfolgen ein philosophisches Ziel und entwickeln ihre Ordnung philologisch, wenn Nietzsche seine überschießenden Einfälle kommentiert und textkritisch Diese dreifache Vernunft leitet die Kreativität und deren "Arbeit am Sinn". Angesichts ihrer Komplexität sind die Werke nur unter Verlusten den einzelnen Disziplinen zugä der Literaturwissenschaft, der Philosophie und den Philologien. Daher übt sich dieses Buch in einer kritischen, insistierenden, die Vernunftformen engführenden Lektüre. Die Lektüre ist kritisch, weil sie ihre Praxis theoretisch betrachtet und das in wissenschaftshistorischer Klarheit tut. Die Lektüre insistiert, wo sie stets wieder zum kreativen Gang der Werke zurückkehrt. Die Lektüren als raison d`être des Buchs gelten exemplarischen Kapiteln des "Zarathustra" und allen neun "Dithyramben", und sie spiegeln sich in der entschiedenen Analyse bisheriger Forschungstopoi - vertreten durch Lou Andreas-Salomé, Heidegger, Bennholdt-Thomsen, Kommerell, Schlaffer, Groddeck und anderen.
Akademische Disziplinen haben ihre Geschichte. Sie drückt sich nicht zuletzt in den Strategien aus, den jeweils eigenen Gegenstandsbereich gegenüber den anderen Disziplinen abzugrenzen und gleichzeitig seine Bedeutung herauszustellen: für das akademische Feld im engeren Sinn ebenso wie für die gesellschaftliche Wissenskultur im ganzen. Die Maxime der Interdisziplinarität, die insbesondere die „Kulturwissenschaft“ seit einiger Zeit auf ihre Fahnen geheftet hat, ist da lediglich die Kehrseite einer disziplinären Einhegung der Wissensbereiche. Um diese Entwicklung einschätzen zu können, ist ein Blick auf die Geschichte der „Kulturwissenschaften“ avant la lettre aufschlußreich. Einen solchen Blick werfen die Autoren dieses Bandes auf die Paradigmen und Leitvorstellungen der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften um 1900. Es geht dabei sowohl um die innerakademischen Positionierungen wie um die Begründungen der wissenschaftlichen und gesellschaftlich-kulturellen Relevanz der verschiedenen, teilweise neuen Fächer. Dabei handelt es sich nicht nur um einen wissenschaftsgeschichtlichen Rückblick, der die Genese von Wissensansprüchen und ihre akademische Institutionalisierung nachzeichnet, sondern auch um einen Beitrag zu aktuellen Diskussionen über Nutzen und Nachteil von bestehenden Fächergrenzen.
Geschichte der Philologien± (bis 2019 ?Geschichte der Germanistik±) feiert 2021 ihr 30-järiges Bestehen. Seit 1991 war die Zeitschrift das Organ germanistischer Wissenschaftsgeschichtsforschung. Aus der Beobachtung anderer, benachbarter Philologien wurde allmählich eine Komparatistik der Fächer, im Sinn des historischen Vergleichs und der philosophischen Reflexion. Neben Forschungsbeiträgen zu den einzelnen Philologien werden Inedita präsentiert, Neuerwerbungen in Literatur- und Universitätsarchiven vorgestellt und Forschungsprojekte skizziert. Jedes Doppelheft enthält eine ausführliche, kommentierte Bibliographie der Neuerscheinungen.00Mit Beiträgen u. a. von: Felix Christen, Norbert Groeben, Beatrice Gruendler, Stefan Litt, Yuji Nawata, Nguyen Giang Huong, Norbert Oellers, Isabel Toral und Jürgen Trabant
Kreativität
Lektüren von Rilkes ›Duineser Elegien‹
Rilke schrieb seinen Gedichtzyklus »Duineser Elegien« in dem langen Jahrzehnt von 1912 bis 1922. Ein Werkkomplex entstand, der die zehn großen, kanonisch gewordenen Elegien umfasst und ebenso »Fragmentarisches« – so nannte Rilke einen zweiten Band, der mit dem Zyklus im Jahr 1923 erscheinen sollte. Dazu kam es freilich nicht. Die Lektüren von Christoph König gelten allen Gedichten des Zyklus und des Fragmentarischen jeweils individuell. Sie entfalten den Werkkomplex unter dem Gesichtspunkt der „Kreativität“. Die Frage lautet: Welches sind die Bedingungen, die die Gedichte jeweils möglich machen? Eine Wiegebewegung zwischen Zauberei und Redlichkeit zeigt sich, die die großen Themen Liebe, Tod, Krankheit und vor allem Kunst erfasst. Diese Redlichkeit besteht in der Skepsis, die sich stets durchsetzt - die Gedichte wissen, dass sie von etwas Transzendentem nur träumen, es aber nicht fassen können. So bleibt dem Dichter allein die Gedankenarbeit in der Sprache. - Ein Epilog zur Kritik der Überwältigung beschließt die Lektüren. Das Buch bildet mit seinen Interpretationen das Gegenstück zum ersten, von Christoph König herausgegebenen Band der neuen historisch-kritischen Ausgabe der „Werke“ Rilkes, der die „Duineser Elegien und die zugehörigen Gedichte enthält.
»O komm und geh«
Skeptische Lektüren der ›Sonette an Orpheus‹ von Rilke
Der Blick auf ein einzelnes Gedicht eröffnet eine neue Sicht auf Rainer Maria Rilke. Christoph König nimmt in seinem Buch ein einzelnes Gedicht in den Fokus: »O komm und geh« aus Rilkes Zyklus »Die Sonette an Orpheus« (1922). Große Gedichte, schreibt er, sind wie Subjekte, ebenso entschieden wie selbständig, und sie erheben den Anspruch, gemäß ihrer Eigenart gelesen zu werden. König interpretiert das Gedicht und zeigt die Voraussetzungen seiner Lektüre: Rilkes Idiomatik, die Aneignung literarischer Traditionen, seine Korrespondenz, die 55 Sonette des Zyklus als die Welt des Sonetts, und vor allem die Selbstreflexion der Gedichte. Ein neues Bild Rilkes entsteht: Hinter dem populären, esoterischen, philosophischen oder mythopoetischen Autor wird der Skeptiker greifbar, der in seinem Werk über die Möglichkeitsbedingungen poetischer Erkenntnis nachdenkt. Königs Lektüre, die immer wieder zu dem Gedicht zurückkehrt, umfasst in gleichem Maß die Interpretationsgeschichte, der sie gegenübertritt: König stellt sie in zwanzig Lektüreporträts - von Heidegger, Wittgenstein, Paul Hoffmann, Beda Allemann, Ulrich Fülleborn, Celan oder Eich - dar. Somit liegt ein Buch über einen neuen »Rilke« vor, und ein Buch, das das Potential einer wissenschaftsgeschichtlich aufgeklärten, kritischen Hermeneutik demonstriert.