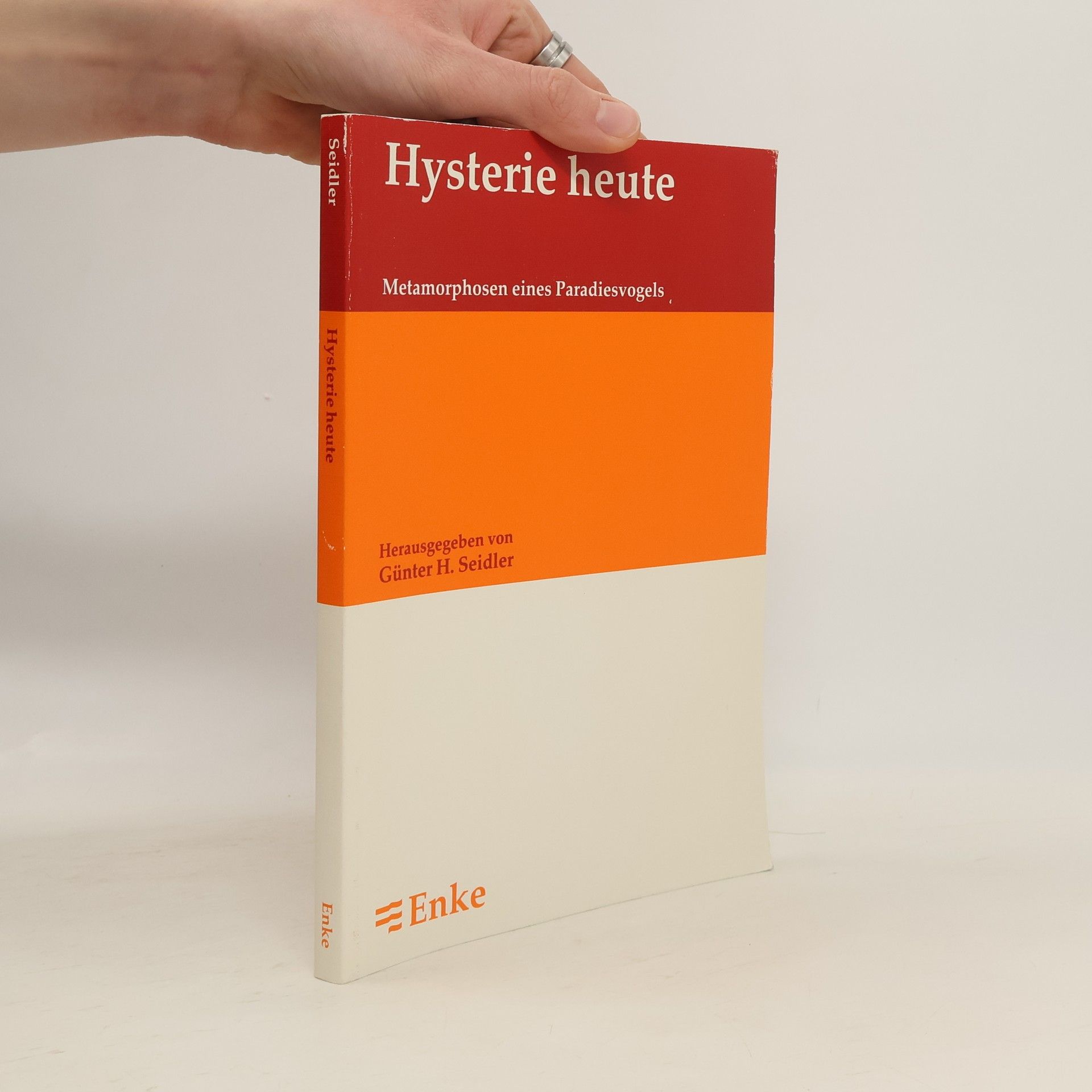Die 65 Kapitel befassen sich mit den Themen: - Definition und Beschreibung der Psychotraumatologie - Historische Entwicklung - Krankheitsbilder - Alle Therapiemöglichkeiten - Traumatisierungen in bestimmten gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten - Trauma und Justiz - Traumafolgestörungen in forensischen Kliniken sowie bei helfenden Berufen Insbesondere wird diskutiert: - Wie entstehen Psychotraumata? - Welchen Verlauf können sie nehmen? - Welche Möglichkeiten der Behandlung, Versorgung und Betreuung gibt es? - Was sind die gesellschaftlichen Zusammenhänge und Voraussetzungen? Zielgruppe: - PsychotraumatologInnen - PsychotherapeutInnen (insb. mit Trauma-Weiterbildung) - PsychoanalytikerInnen / Psychiater / PsychologInnen - Führungskräfte und Mitarbeiter in »Blaulichtberufen« und Beratungsstellen - SozialarbeiterInnen / SeelsorgerInnen - ErzieherInnen, insb. in Einrichtungen für Schwer- und Schwersterziehbare Studierende
Günter H. Seidler Boeken
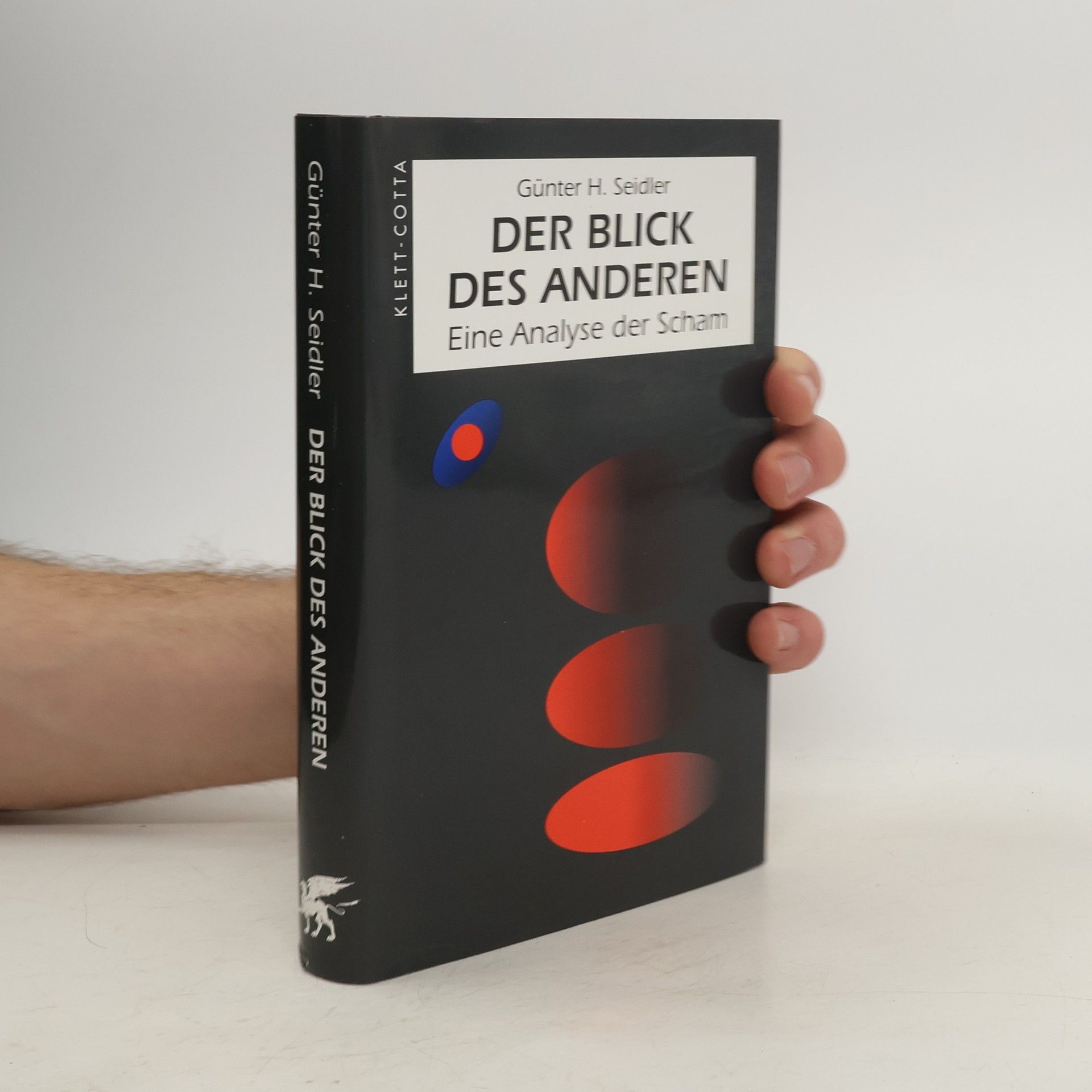


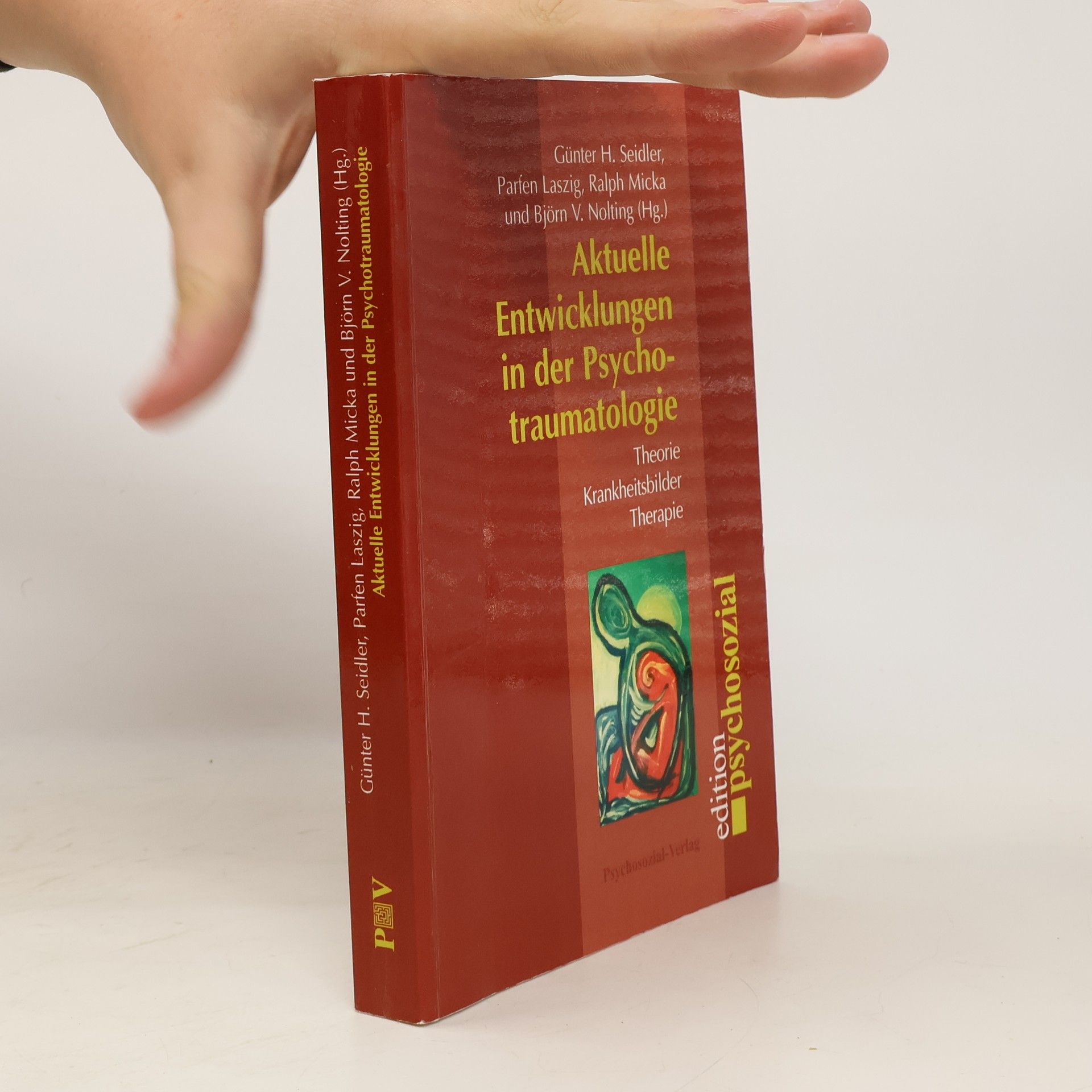
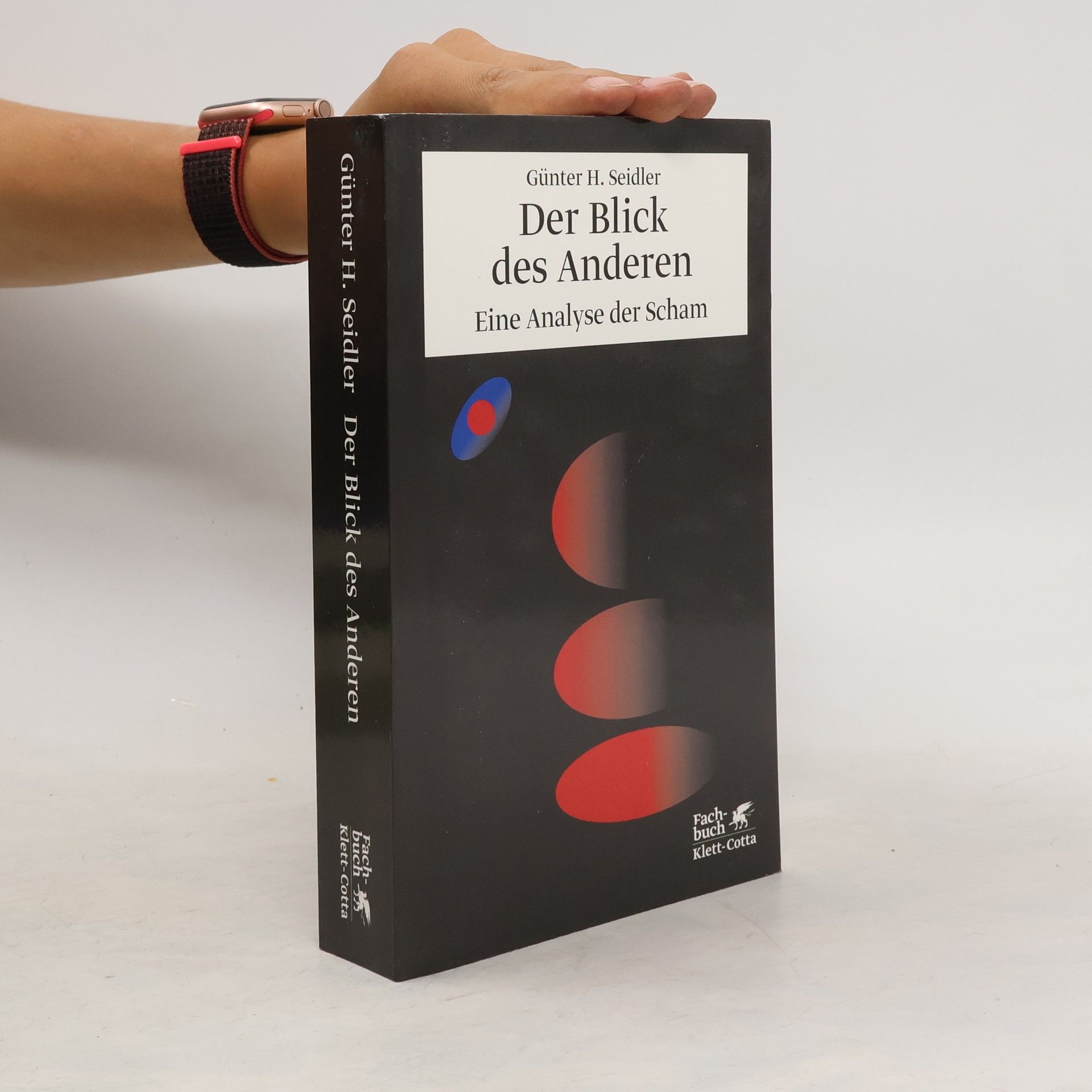

Der Blick des Anderen
Eine Analyse der Scham
Analyse eines lange vernachlässigten Affekts »Diese Arbeit füllt eine bisher spürbare Lücke in unseren Kenntnissen über Scham, ihre Störungen und ihre Einflüsse auf die menschliche Entwicklung. Seidlers gedankenreiche, aufgeschlossene und anregende Art, Theorie und klinische Realität auf den Prüfstand zu stellen, sollte für jeden psychoanalytisch Tätigen eine Bereicherung sein.« Otto F. Kernberg
Aktuelle Entwicklungen in der Psychotraumatologie
Theorie – Krankheitsbilder – Therapie
Die Psychotraumatologie hat sich in den letzten Jahren zu einem relativ eigenständigen Forschungs- und Versorgungsbereich entwickelt. Sie integriert Befunde aus sehr unterschiedlichen Disziplinen, von der Neurobiologie über die Psychosomatik und Psychotherapie bis hin zu den Sozialwissenschaften. Die Autorinnen und Autoren – international anerkannte Experten – versuchen eine Bestandsaufnahme im Sinne eines 'State of the Art' im Bezug auf neurobiologische Theorien, der Konzeptualisierung von Krankheitsbildern und hinsichtlich der unterschiedlichen therapeutischen Ansätze in diesem Feld. So werden die aktuellen neurobiologischen Erkenntnisse, die zum Verständnis von Traumafolgestörungen notwendig sind, ausführlich dargestellt. Zudem werden die wichtigsten psychotraumatischen Traumafolgestörungen aufgezeigt. Das Buch schließt mit einer Darstellung der momentan wirksamsten Traumatherapieverfahren.
Magersucht
Öffentliches Geheimnis
Magersucht ist immer noch kaum behandelbar. Bei Mädchen und jungen Frauen gilt sie als Ausdruck ihrer Weigerung, erwachsen und weiblich zu werden. Diese verbreitete Vorstellung ist jedoch zu simpel und wird daher in diesem Band angezweifelt. Anhand klinischer Erfahrungen werden auf wissenschaftlicher Grundlage die komplexen Zusammenhänge herausgearbeitet, die dieser Krankheit zugrunde liegen. Die vorliegenden Beiträge befassen sich aus dem Blickwinkel unterschiedlicher therapeutischer Schulen mit den verschiedenen Formen der Erkrankung, mit Modellen zum theoretischen Verständnis und mit Möglichkeiten der Therapie. Statt auf eine schnelle Heilung zu setzen, betonen die Autorinnen und Autoren die Notwendigkeit, zunächst ein umfassendes Verständnis für das Anliegen magersüchtiger Menschen zu entwickeln, um ihnen eine angemessene Behandlung zu ermöglichen. Mit Beiträgen von Monika Becker-Fischer, Brigitte Boothe, Christina von Braun, Michael B. Buchholz, Eva Diebel-Braune, Michael Dümpelmann, Hermann Fahrig, Gottfried Fischer, Hildegard Horn, Günter Reich, Gerhard Schneider, Günter H. Seidler und Léon Wurmser
Fremdes wird auf individueller und gesellschaftlicher Ebene immer weniger akzeptiert. Die Tendenz zur Elimination von Störendem im Dienste eines Harmonie-Ideals wird von den Autorinnen und Autoren des Buches als Hauptmerkmal des „destruktiven Narzißmus“ verstanden. In ihren Untersuchungen ist eine klinische Orientierung vorherrschend. Gleichzeitig wagen sie aber den Versuch eines Brückenschlages zum Verständnis von zunehmender Intoleranz und Gewaltbereitschaft gegenüber Fremdem im gesellschaftlichen Raum.
Der Blick des anderen
- 391bladzijden
- 14 uur lezen
Diese Arbeit füllt eine bisher spürbare Lücke in unseren Kenntnissen über Scham, ihre Störungen und ihre Einflüsse auf die menschliche Entwicklung. Seidlers gedankenreiche, aufgeschlossene und anregende Art, Theorie und klinische Realität auf den Prüfstand zu stellen, sollte für jeden psychoanalytisch Tätigen eine Bereicherung sein. Otto F. Kernberg