Das erweiterte Skillstraining zur affektiven und interpersonellen Regulation (ESTAIR) ist ein Gruppenprogramm für Personen mit Missbrauchserfahrungen, das Skills zur Emotionsregulation, zum Selbstkonzept und zu zwischenmenschlichen Beziehungen vermittelt. Es richtet sich an Menschen, die unter den Folgen traumatischer Ereignisse in der Vergangenheit leiden, insbesondere an denen mit komplexen Posttraumatischen Belastungsstörungen (kPTBS). Diese sind oft durch Schwierigkeiten in der Emotionsregulation, in zwischenmenschlichen Beziehungen und im Selbstkonzept gekennzeichnet. Das Programm basiert auf der Einzeltherapie STAIR/Narrative Therapie (NT), deren Wirksamkeit nachgewiesen ist. Kenntnisse von STAIR/NT sind für die Durchführung des Gruppenprogramms erforderlich, eine Kombination mit Einzeltherapie ist sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig. Das Programm umfasst drei Schwerpunkte: Emotionsregulation, Selbstkonzept und zwischenmenschliche Beziehungen. In 17 Sitzungen werden den Teilnehmern Fähigkeiten vermittelt, die den Umgang mit Gefühlen verbessern, das Selbstbild positiv beeinflussen und gesundes Beziehungsverhalten fördern. Das Gruppensetting bietet einen sicheren Rahmen, um neue Skills zu erproben und korrigierende Beziehungserfahrungen zu sammeln. Die einzelnen Bausteine sind flexibel einsetzbar. Materialien wie Arbeitsblätter und Audiodateien unterstützen die Durchführung und können nach Registrierung von der Hogre
Ingo Schäfer Boeken
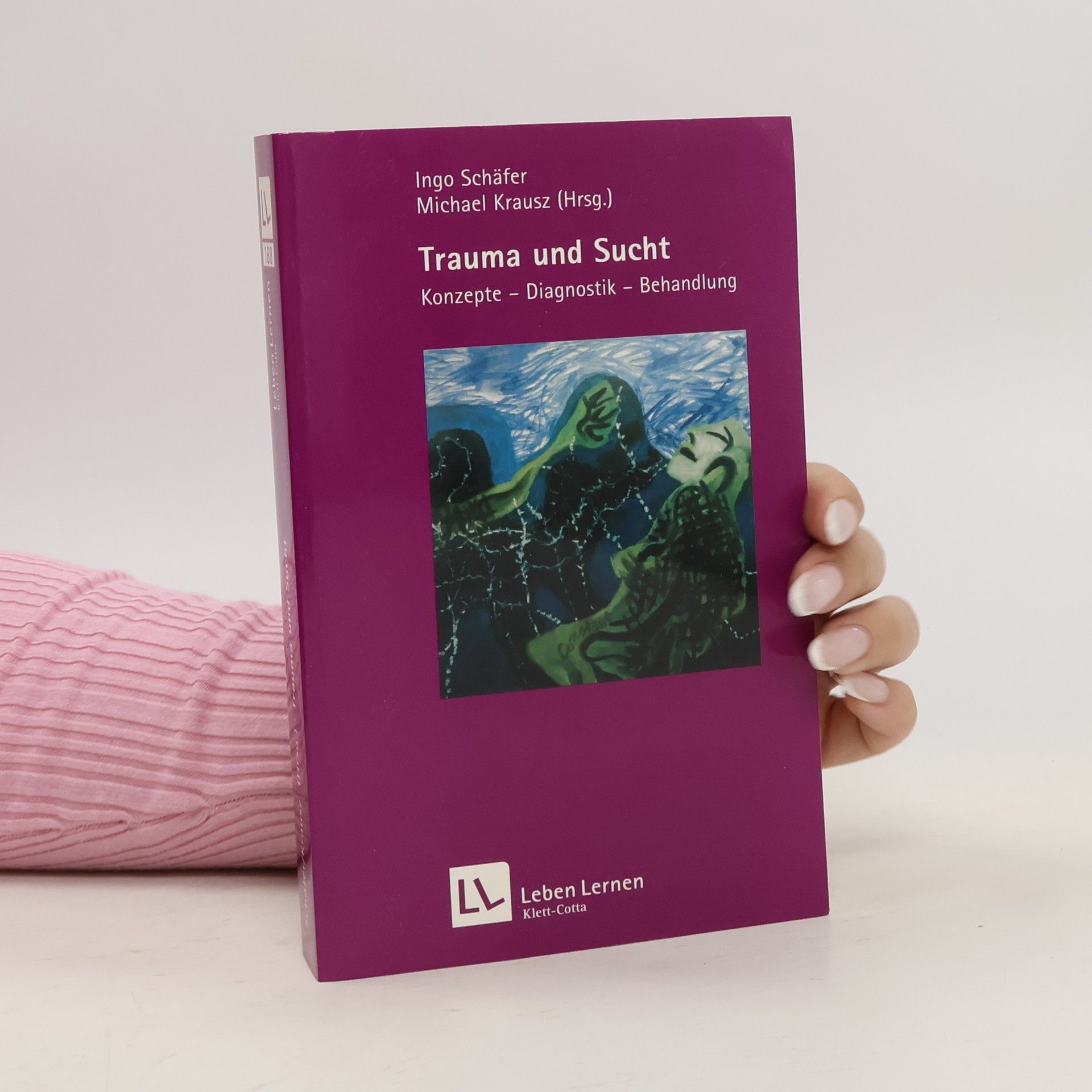

Viele Untersuchungen zeigen, daß Menschen, die sexuellen Mißbrauch oder körperliche Mißhandlung in der Kindheit ertragen mußten, als Erwachsene deutlich häufiger von Alkohol, Drogen oder Medikamenten abhängig wurden als Nichttraumatisierte. Doch weder Suchttherapeuten noch Traumatherapeuten haben diese in der Forschung offenkundigen Zusammenhänge bisher thematisiert. Der Band leistet daher »Pionierarbeit«, indem er zum einen den notwendigen Perspektivenwechsel begründet und zum anderen praktische behandlungstechnische Konsequenzen diskutiert und konzeptualisiert. Die Kernfrage lautet: Wie muß eine spezifische psychotherapeutische Behandlung beschaffen sein, damit Menschen mit Gewalterfahrungen ihre »Selbsttherapie« der Betäubung aufgeben können? Eine wirklich große Herausforderung für die Psychotherapie, für die das Buch erste Orientierung gibt.