Zur Politik. Recht
Ausgabe B
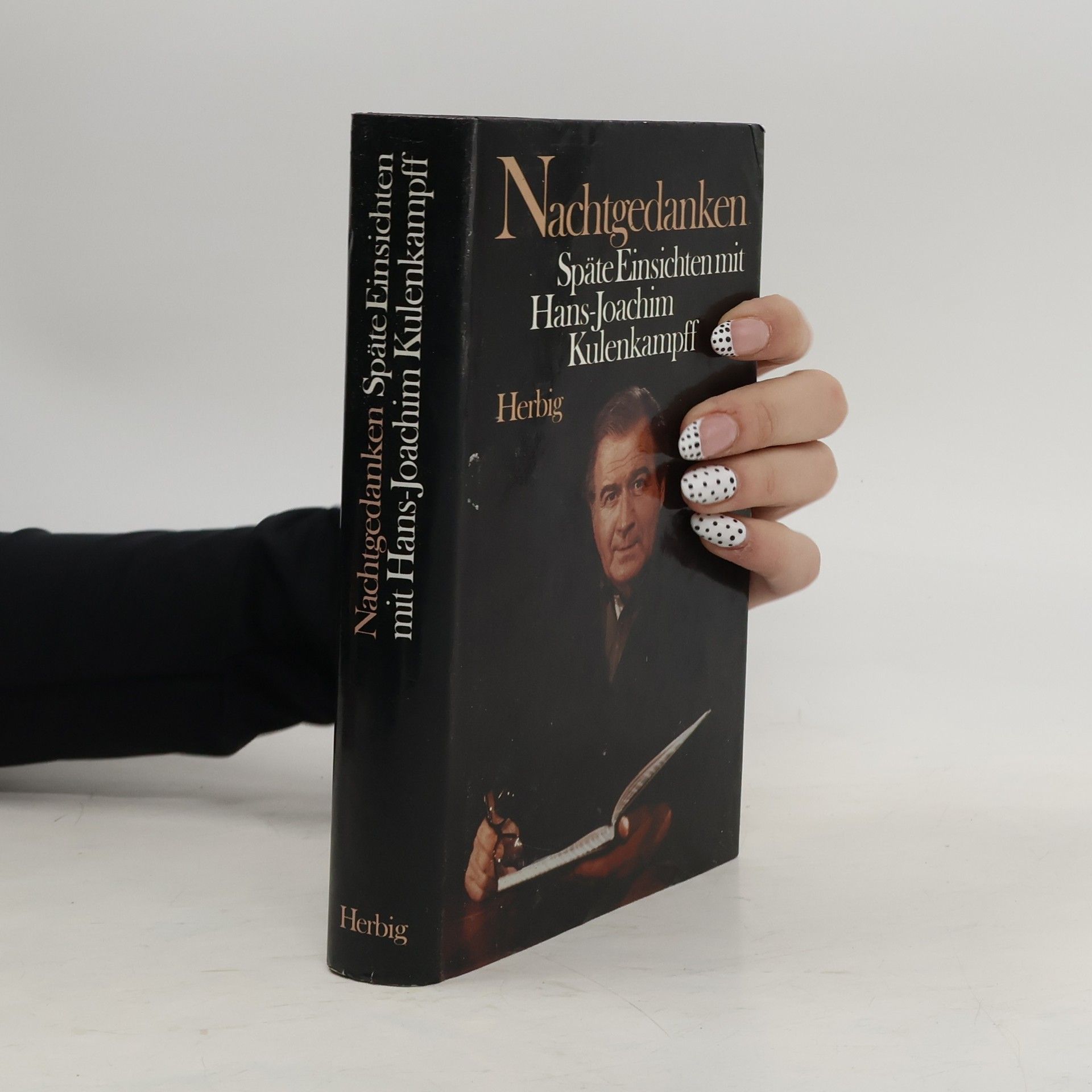


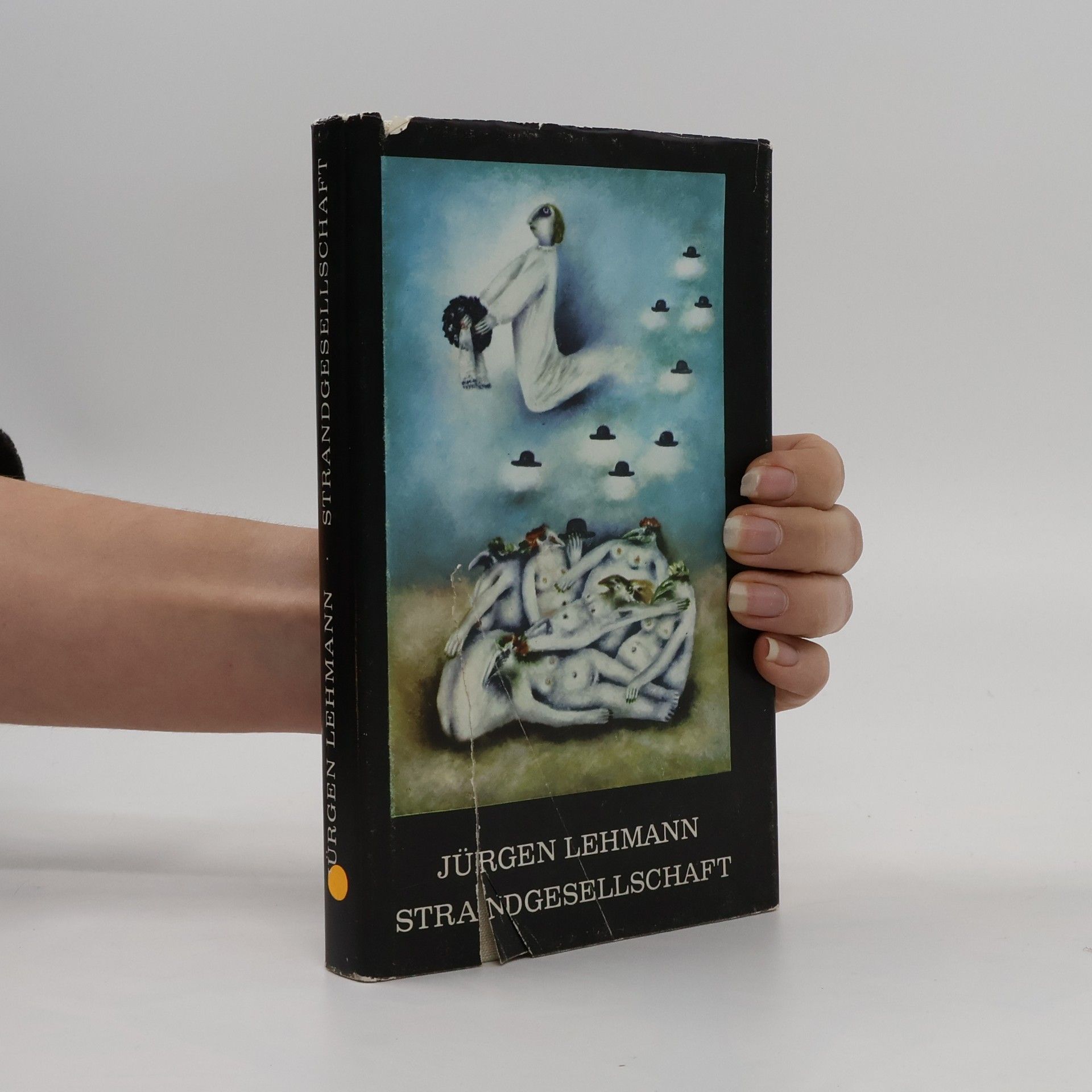

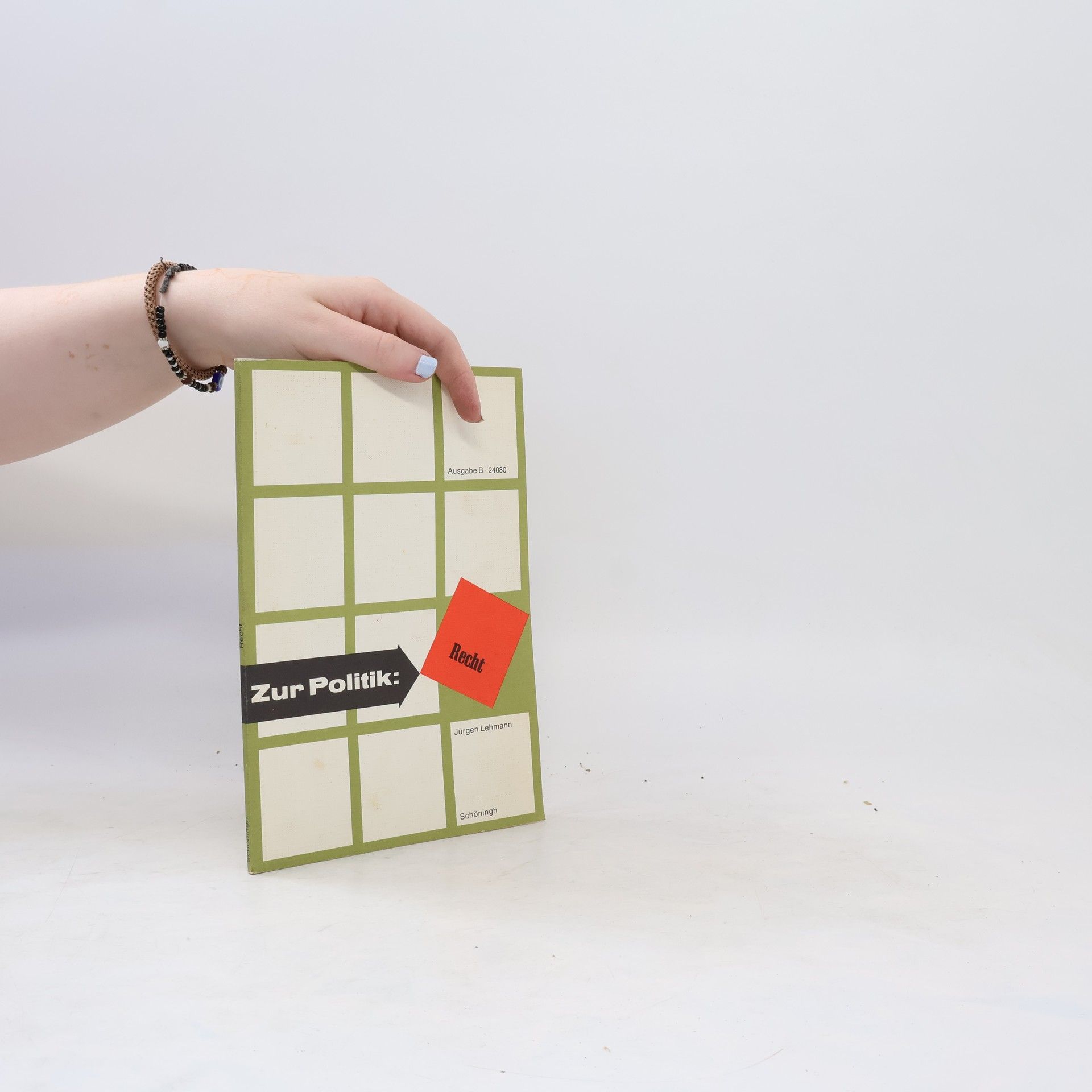
Ausgabe B
Studien zu Theorie und Geschichte der Literatur
Der Band beleuchtet die umfangreiche literaturwissenschaftliche Arbeit von Jürgen Lehmann, einem Experten für deutsche und slawische Literatur sowie deren Vergleich. Im ersten Teil werden zentrale Themen wie Dialog und Begegnung behandelt, inspiriert von Michail Bachtins Theorien, und untersucht die deutsch-russischen Literaturbeziehungen sowie literarische Topographien. Der zweite Teil widmet sich den Themen Zeit und Erinnerung, mit Analysen zu Schiller, der Autobiographie und moderner deutschsprachiger Lyrik. Lehmanns vielfältige Interessen und Ansätze werden eindrucksvoll dokumentiert.
Die Autobiographie des Literaturwissenschaftlers Jürgen Lehmann beschreibt die geistige Entwicklung eines jungen Mannes in der Nachkriegszeit bis 1974. Im Spannungsfeld der so verschiedenen Gesellschaftssysteme von DDR und Bundesrepublik hat die von Enttäuschung und Hoffnung, Verlust und Gewinn geprägte, entbehrungsreiche Zeit zwischen Zerstörung und Neuanfang ihre Spuren hinterlassen. Auf Kindheit und Jugend in der jungen DDR folgt die Flucht in den Westen. Nach einer schwierigen Orientierungssuche in der Bundesrepublik der Adenauer-Zeit gelingt Lehmann die gesellschaftliche Integration. So beginnt seine vielversprechende akademische Laufbahn in Freiburg im Breisgau. Aus dem wachsenden Interesse für slawische Literaturen erwächst seine erneute Orientierung gen Osten. Diese gipfelt im für die spätere Laufbahn als akademischer Vermittler zwischen deutscher und russischer Literatur bedeutungsvollen Studien- und Forschungsaufenthalt in Moskau und Leningrad.
Die im vorliegenden Band versammelten literaturwissenschaftlichen Untersuchungen dokumentieren eine jahrzehntelange Beschaftigung ihres Autors mit dem Dichter und Ubersetzer Paul Celan. Im Zentrum stehen zum einen Gedichtinterpretationen und Analysen poetologischer Texte, die aus von der Deutschen Forschungsgemeinschaft viele Jahre geforderten Kommentar-Projekten hervorgegangen sind, sowie zwei vergleichende Studien zum Verhaltnis Celan - Goethe und Celan - Heine. Zum anderen sind es komparatistische Arbeiten, welche die fur Celan uberaus wichtige dichterische Auseinandersetzung mit dem russischen Dichter Osip Mandel'stam beleuchten. Dies wird erganzt durch Analysen von Celans Ubertragungen aus dem Russischen, die seinen kreativen Umgang mit den Vorlagen demonstrieren und seine Ubersetzungen eher als eigene Akzente setzende Nachdichtungen erscheinen lassen.