Výjimečně prozíravý, ba prorocký text napsaný téměř před pěti sty lety přináší pronikavou úvahu s nadčasovou platností o podstatě tyranské vlády a poddanství. Její autor jako první v dějinách evropského myšlení obrací naruby tradiční představu o vztahu mezi vládcem a ovládaným, mezi pánem a rabem. Nezaměřuje se totiž na analýzu moci, mocenského aparátu, nýbrž vychází z vůle pokořeného, z jeho chtění: ovládaný není pasivní obětí v rukou despotického tyrana, nýbrž sám chce být ovládán. Proč?
Étienne de La Boétie Boeken
Étienne de La Boétie was een Franse filosoof en schrijver, beschouwd als een grondlegger van de moderne politieke filosofie in Frankrijk. Hij is vooral bekend als de grote vriend van Michel de Montaigne. Zijn werk heeft het anarchistische denken aanzienlijk beïnvloed. La Boétie's geschriften verkennen thema's als natuurrecht en vrijheid.




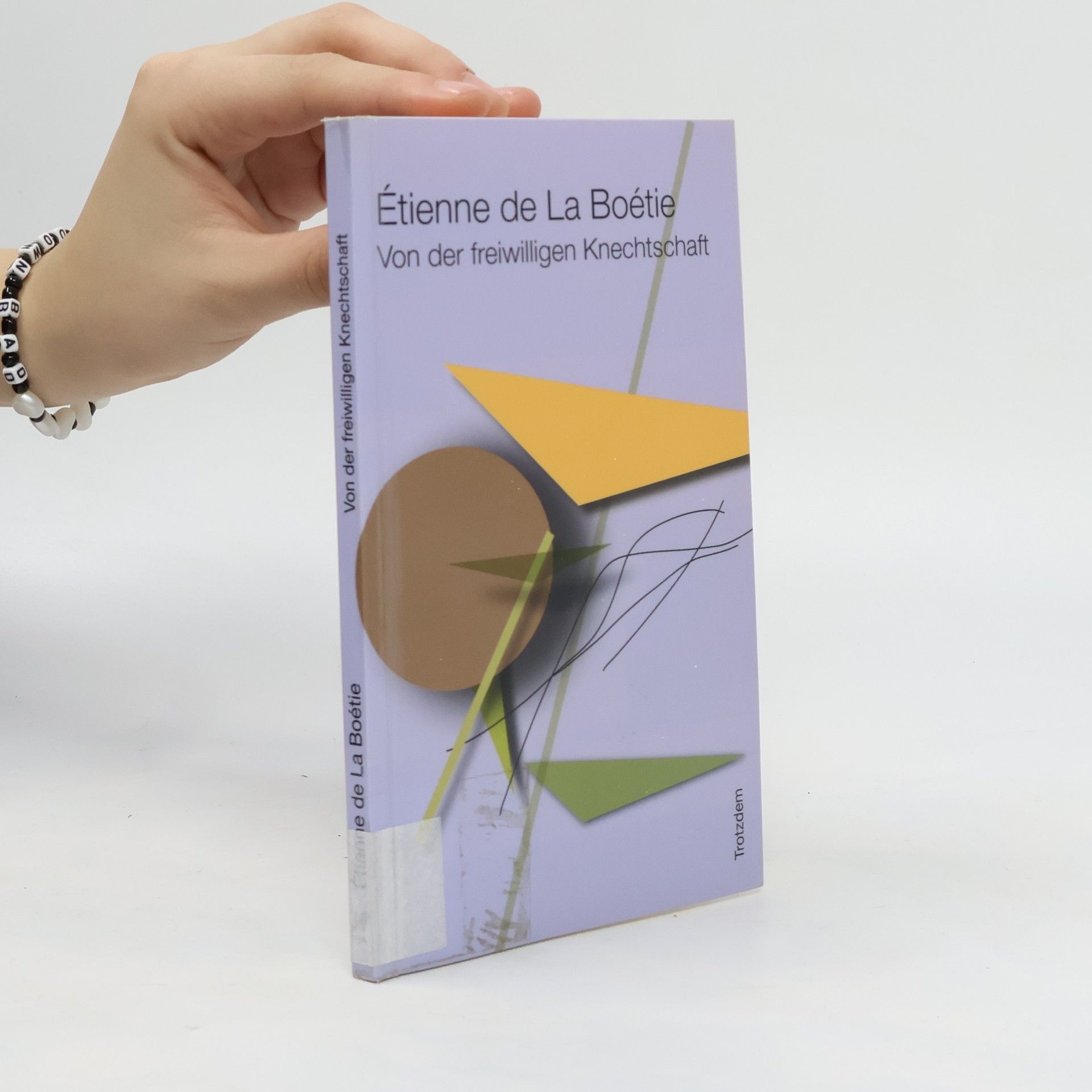

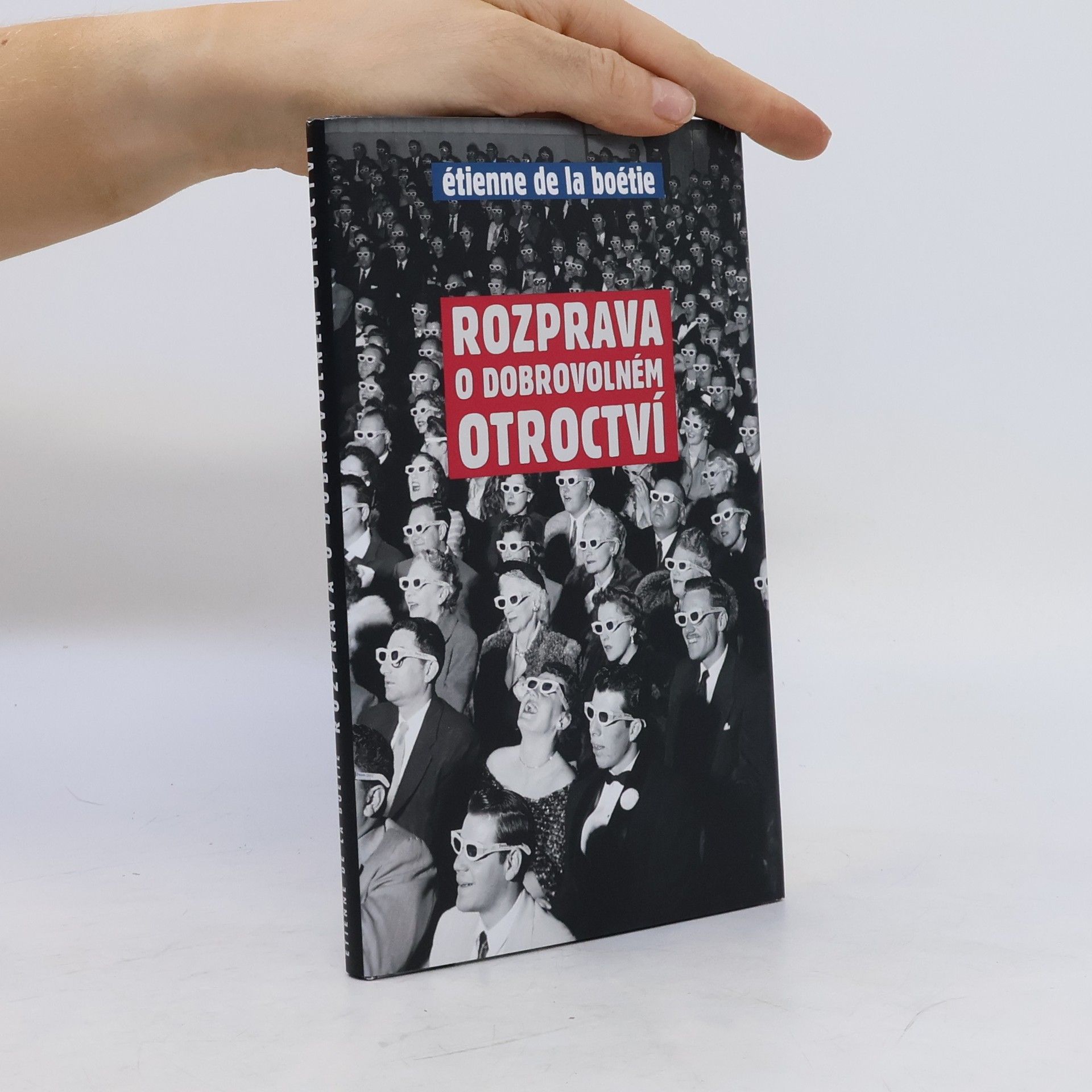
Von der freiwilligen Knechtschaft des Menschen
Ins Deutsche übertragen von Gustav Landauer
Der Discours von La Boétie untersucht, wie Menschen freiwillig Tyrannei akzeptieren. Er fragt, warum ein Tyrann Macht über die Bürger hat und betont, dass Unterdrückte oft selbst zur Unterdrückung beitragen. Der Text wird durch Kommentare von Landauer und Nettlau ergänzt, die die Thematik weiter vertiefen.
Die kleine Schrift aus dem 16. Jahrhundert Discours de la servitude volontaire, verfasst von dem französischen Renaissance-Humanisten Étienne de La Boétie, gilt heute als wegweisender Meilenstein in der Entwicklung und Formulierung des europäischen Freiheitsgedankens und der politischen Ideenbildung. Anfang des 20. Jahrhundert durch Gustav Landauer wieder entdeckt, stellte er La Boéties Herrschaftsanalyse, dessen Darlegung gewaltsamer Unterdrückung und freiwilliger Unterwerfung, in eine Reihe mit dem, was in anderen Sprachen später Godwin und Stirner, Proudhon, Bakunin und Tolstoi aufnehmen werden. La Boéties Freiwillige Knechtschaft ist ein demokratischer Urtext des Abendlandes und hat die Neuzeit mit den Leitideen Partizipation, Gleichheit und Gerechtigkeit eingeläutet. Sowohl in der politischen Philosophie als auch in demokratischen und bürgerschaftlichen Bewegungen wird der Text bis heute rezipiert. Étienne de La Boétie(1530-1563), französischer Schriftsteller und Freund Montaignes, verfasste neben seinem Discours de la servitude volontaire, der erstmals 13 Jahre nach seinem Tode erschien, zahlreiche Sonetten und Latein-Verse und übersetzte Xenophon und Plutarch. Als Katholik und Rechtsanwalt, später Mitglied des Parlaments von Bordeaux, nahm er im Verlauf der damaligen Religionskriege an diversen Verhandlungen zwischen Protestanten und Katholiken teil und wurde zu einer Stimme für Toleranz in den Zeiten der Inquisition.
Freiwillige Knechtschaft
Französisch-Deutsch
Der Titel „Freiwillige Knechtschaft“ regt zum Nachdenken an: Wer wählt schon freiwillig die Unfreiheit? Étienne de La Boétie, der Autor, sieht darin keinen Sinn, da die Unterdrückten zahlenmäßig überlegen sind. Er fragt sich, wie tyrannische Herrschaftsverhältnisse entstehen und lange bestehen können. In seinem um 1548 verfassten Text, der erst nach seinem Tod im späten 16. Jahrhundert veröffentlicht wurde, analysiert La Boétie die Ursachen für diese Unterwerfung. Er untersucht die Macht der Gewohnheit und die Faszination, die von Herrschaft ausgeht, und wie sie die Massen beeinflusst. Seine Analyse ist radikal; er unterstellt den Unterdrückten, dass sie nicht an der Unterwerfung interessiert sind. Vielmehr zeigt er, dass politische Befreiung darin besteht, das eigene Freiheitsbegehren zu erkennen. Herrschaft kann nicht nur durch Gegengewalt überwunden werden. Die neu übersetzte, kommentierte Edition in der Philosophischen Bibliothek macht diesen heimlichen Klassiker der politischen Philosophie der Neuzeit erstmals in einer wissenschaftlichen deutschen Ausgabe zugänglich.