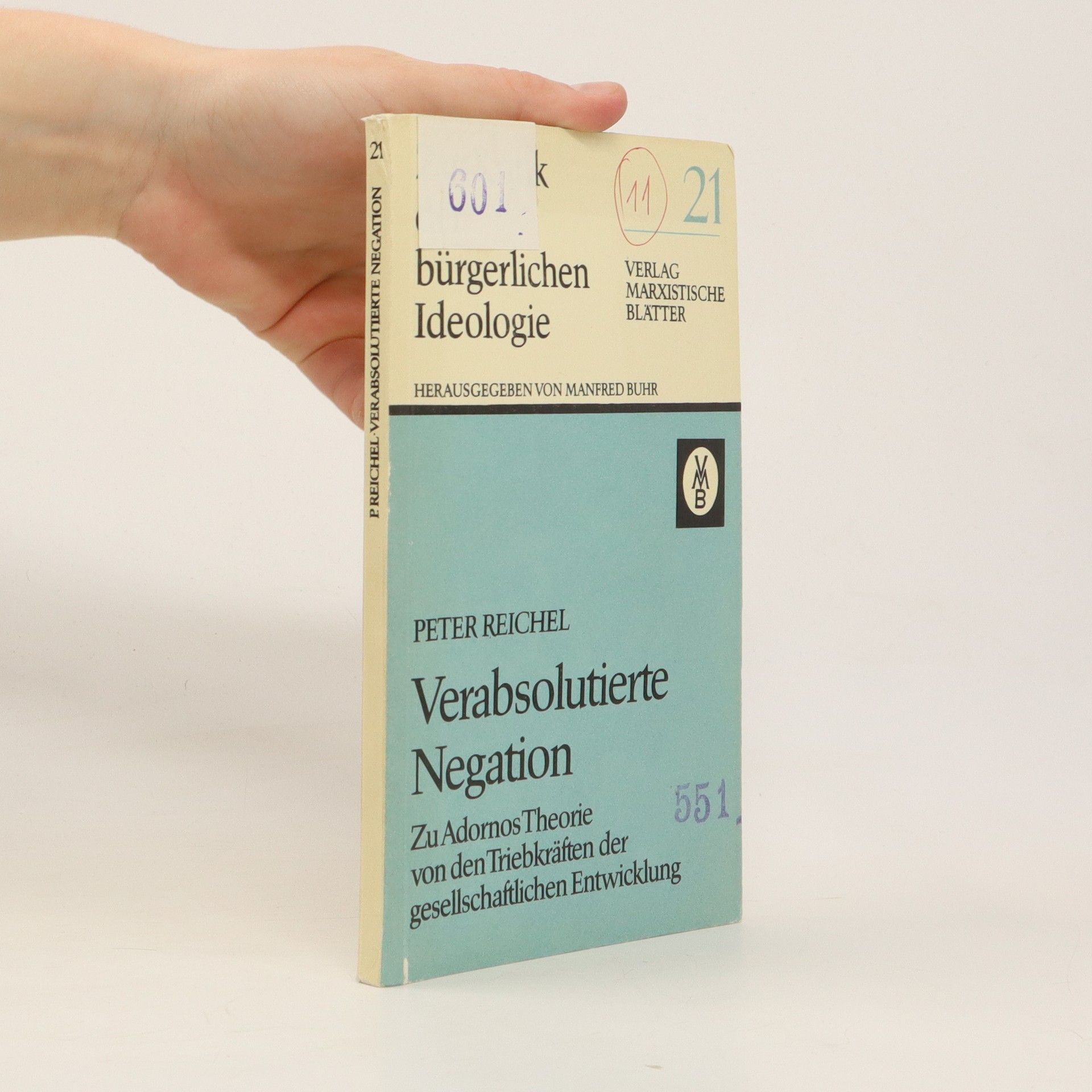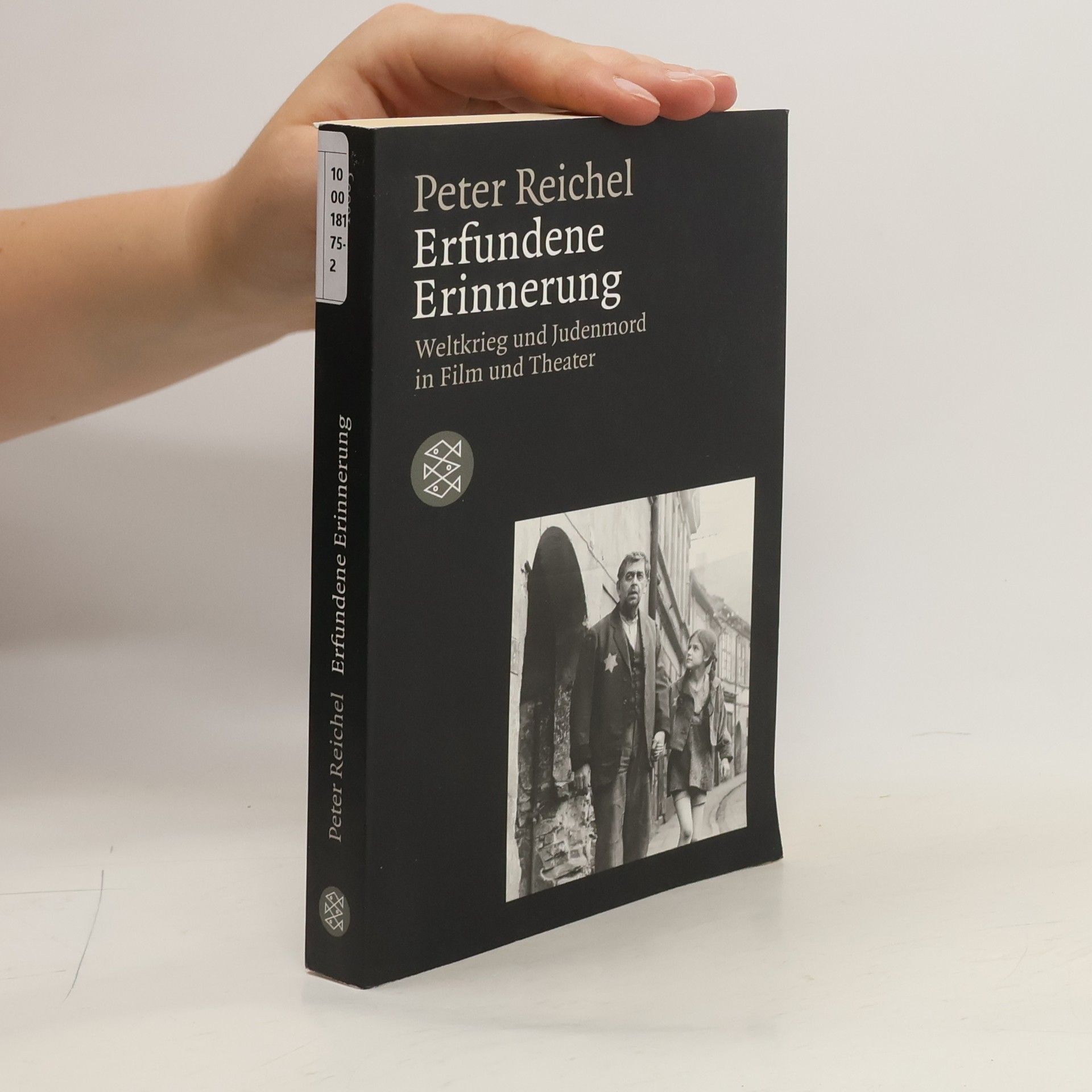Peter Reichel Boeken


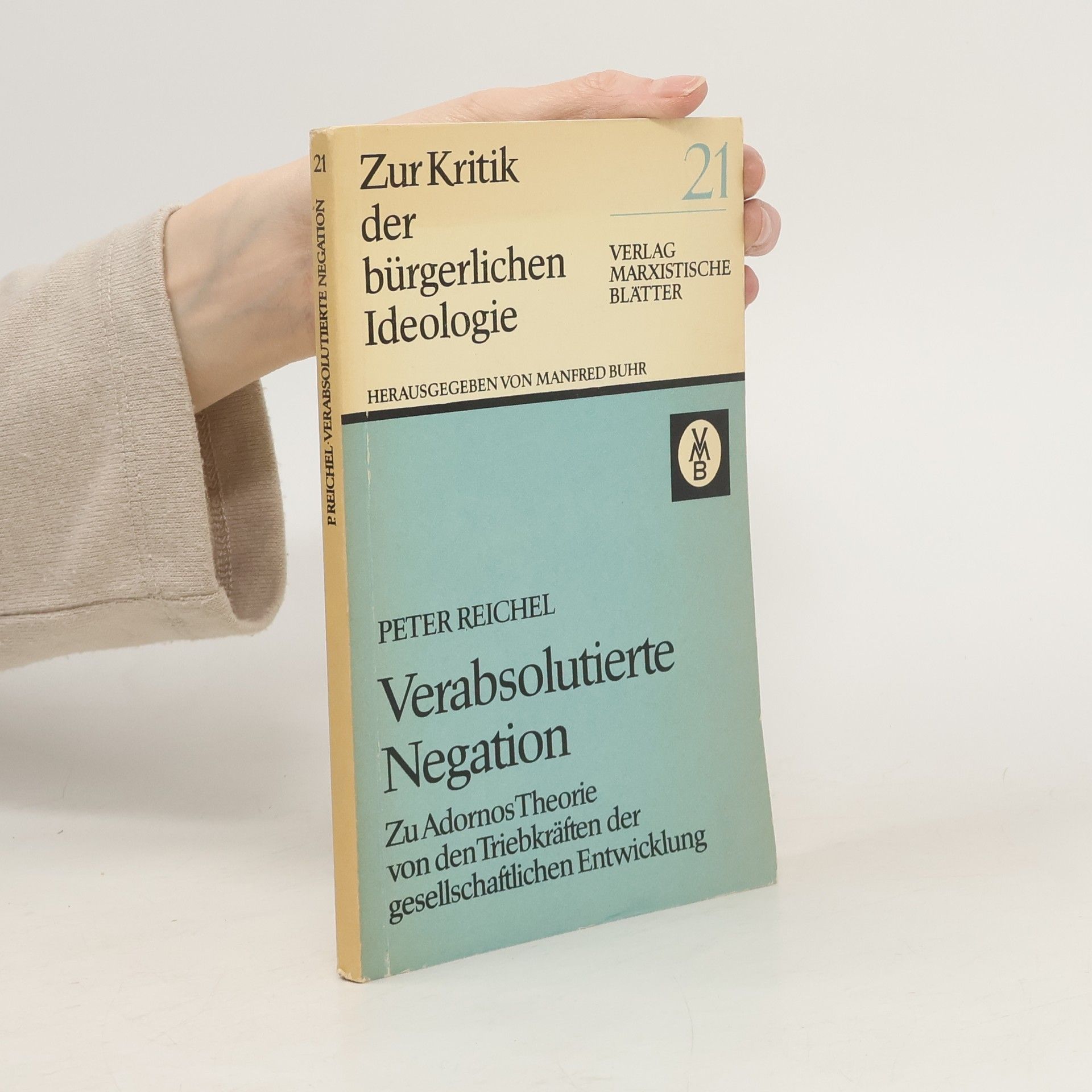
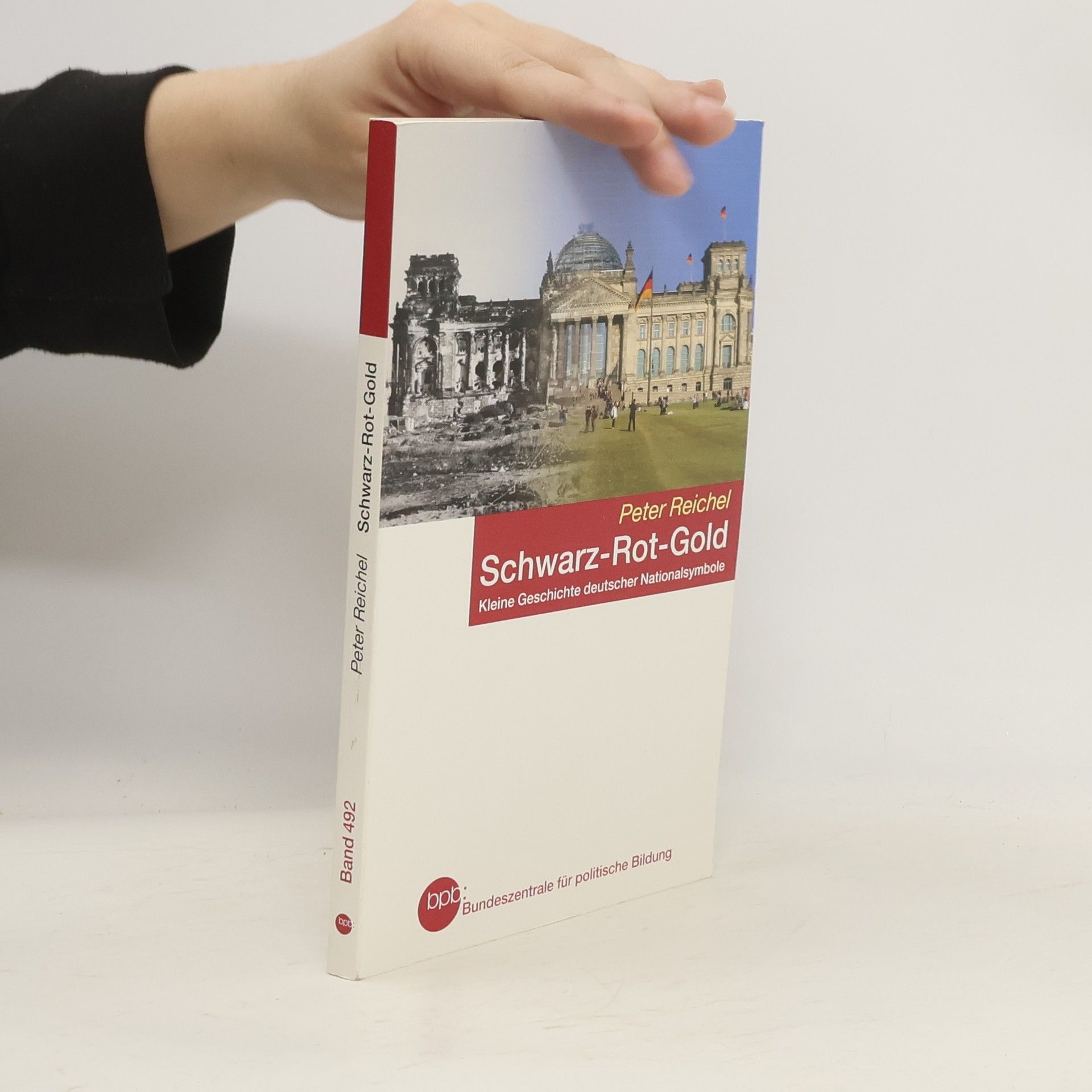



Von der Entnazifizierung und den Nürnberger Prozessen über den Auschwitz-Prozess und die Verjährungsdebatten bis zur Entschädigung der Zwangsarbeiter und zur immer noch aktuellen Kontroverse um das Holocaust-Mahnmal beschreibt der Autor Peter Reichel, Professor für Politische Wissenschaft an der Universität Hamburg, wie die Deutschen politisch, juristisch und letzlich auch moralisch mit der NS-Vergangenheit umgegangen sind.
Podtitul: Fascinující a násilná tvář fašismu. Práce německého profesora politických věd na univerzitě v Hamburku Petera Reichela je významnou analýzou povahy režimu nacistického Německa a současně důležitým příspěvkem k dějinám jeho každodennosti. Kniha přehledně analyzuje spojitou úlohu politiky, násilí, ideologie, kultury, umění a propagandy v každodenním životě třetí říše a její autor zasvěceně dokládá propojenost všech těchto složek a jejich prolnutí nacistickou ideologií, která usilovala o ovládnutí německé společnosti a její podřízení cílům nacistické politiky. Velkou předností práce Petera Reichela je také zdařilý způsob výkladu náročného tématu role politiky, ideologie a kultury a umění v režimu třetí říše a v neposlední řadě i její rovina metodologická spočívající v syntetizujícím uplatnění metod klasické historiografie politických dějin, kulturních dějin, sociologie i uměnovědy.
Rettung der Republik?
Deutschland im Krisenjahr 1923
Regierungskrise, Ruhrkampf, Hitlerputsch: Der Überlebenskampf der Weimarer Republik 1923 zeigt die Verwundbarkeit von Demokratien. 1923 war für Deutschland ein Jahr der Krisen. Innere Kämpfe belasteten die Besiegten. Frankreich besetzte das Ruhrgebiet, um seine Ansprüche durchzusetzen. Die Kosten für den passiven Widerstand verursachten eine Hyperinflation. Die Große Koalition zerbrach, und die nationale Rechte versuchte in Bayern den Umsturz. Doch der Hitlerputsch misslang. Mit Mühe und Glück konnte Reichspräsident Friedrich Ebert die Republik vorläufig retten - doch zu wenige Menschen wollten ihr noch vertrauen. 1923 wurde symptomatisch für die Instabilität der neuen Demokratie. Peter Reichel erkennt in diesen Ereignissen die Unfähigkeit der Parteien, Konflikte durch Kompromisse und Verhandlungen zu lösen. Anschaulich zeigt er: Der Umgang mit den Krisen von 1923 deutet bereits auf das Ende von 1933 hin.
Der Nationalsozialismus
- 496bladzijden
- 18 uur lezen
Der Umgang der Deutschen mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit Schon bei der Gründung der beiden deutschen Staaten vor 60 Jahren zeichnete sich ab, dass die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit das Selbstverständnis der Deutschen nachhaltig prägen würde. Kein anderes Thema hat das Land - in Ost und West - so herausgefordert wie der Umgang mit dem Dritten Reich. Diese „zweite Geschichte“ des Nationalsozialismus wird hier von führenden Experten in all ihren Facetten erzählt. Die Geschichte des Dritten Reiches wurde während des Kalten Krieges auf beiden Seiten des „Eisernen Vorhangs“ politisch instrumentalisiert. Dagegen engagierten sich kritische Publizisten, Künstler, Wissenschaftler und auch einzelne Politiker. Gleichwohl weigerten sich große Teile der deutschen Bevölkerung lange, den verbrecherischen Charakter des NS-Regimes zu akzeptieren. Das gelang erst mit schmerzlichen Tabubrüchen und erbittert geführten Kontroversen, vom „Holocaust“-Film über den Historiker-Streit bis hin zur „Wehrmachtsausstellung“ und zum Mahnmal für die europäischen Juden. Die nationalsozialistische Vergangenheit wird Deutschland auch in Zukunft begleiten, das Grundmuster einer rivalisierenden Geschichtspolitik, Antifaschismus im Osten und Vergangenheitsbewältigung im Westen, aber wird nicht mehr bestimmend sein.
In der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus wurde entscheidende Debaten durch Filme und Theaterstücke ausgelöst. Peter Reichel gibt zum ersten Mal einen kompakten Überblick über die Bewußtseingeschichte der Bundesrepublik, der DDR und des vereinigten Deutschland: von Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“ (1949) über die Fernsehserie „Holocaust“ (1979) bis zu Roberto Benignis „Das Leben ist schön“ (2000).