Elmar Mittler Boeken
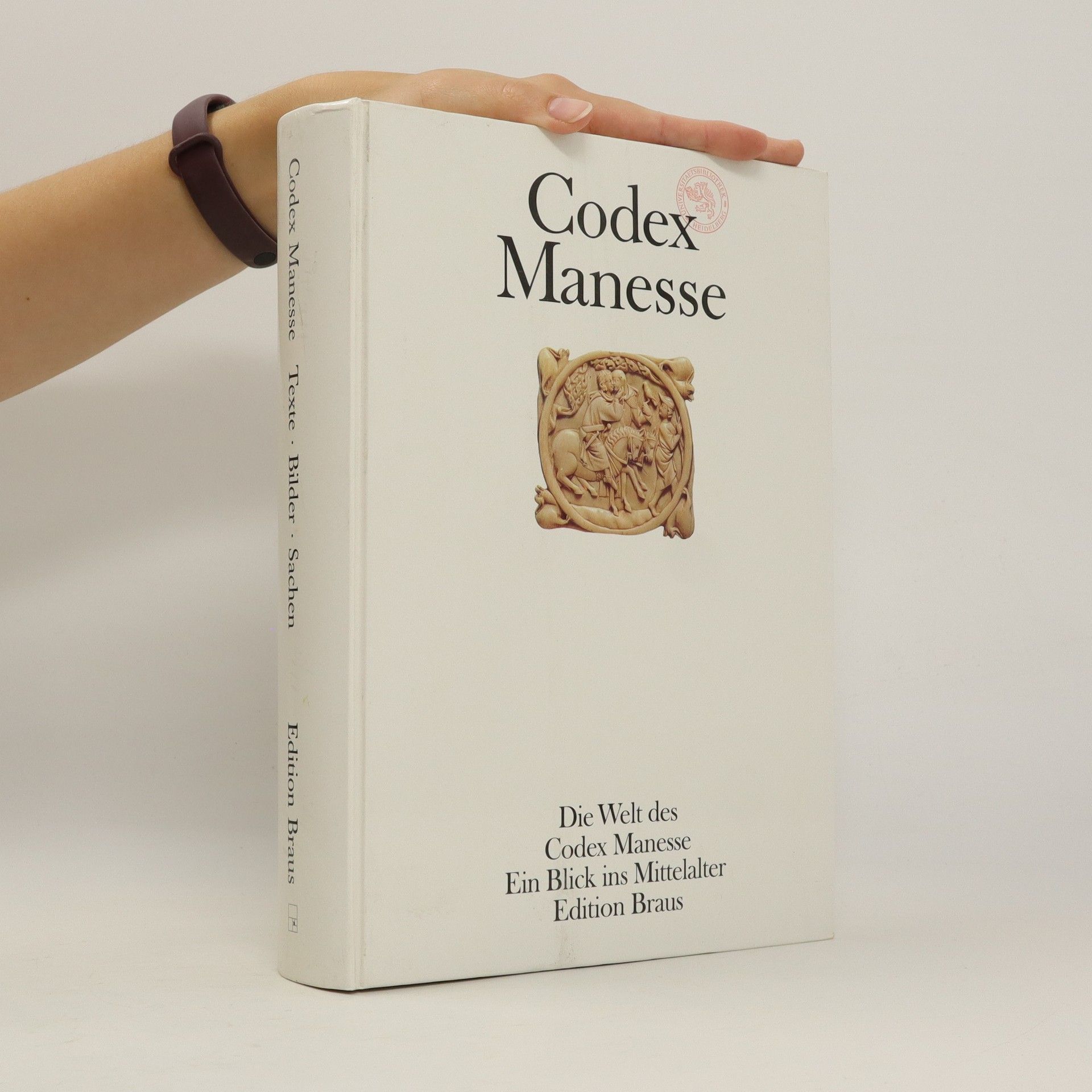

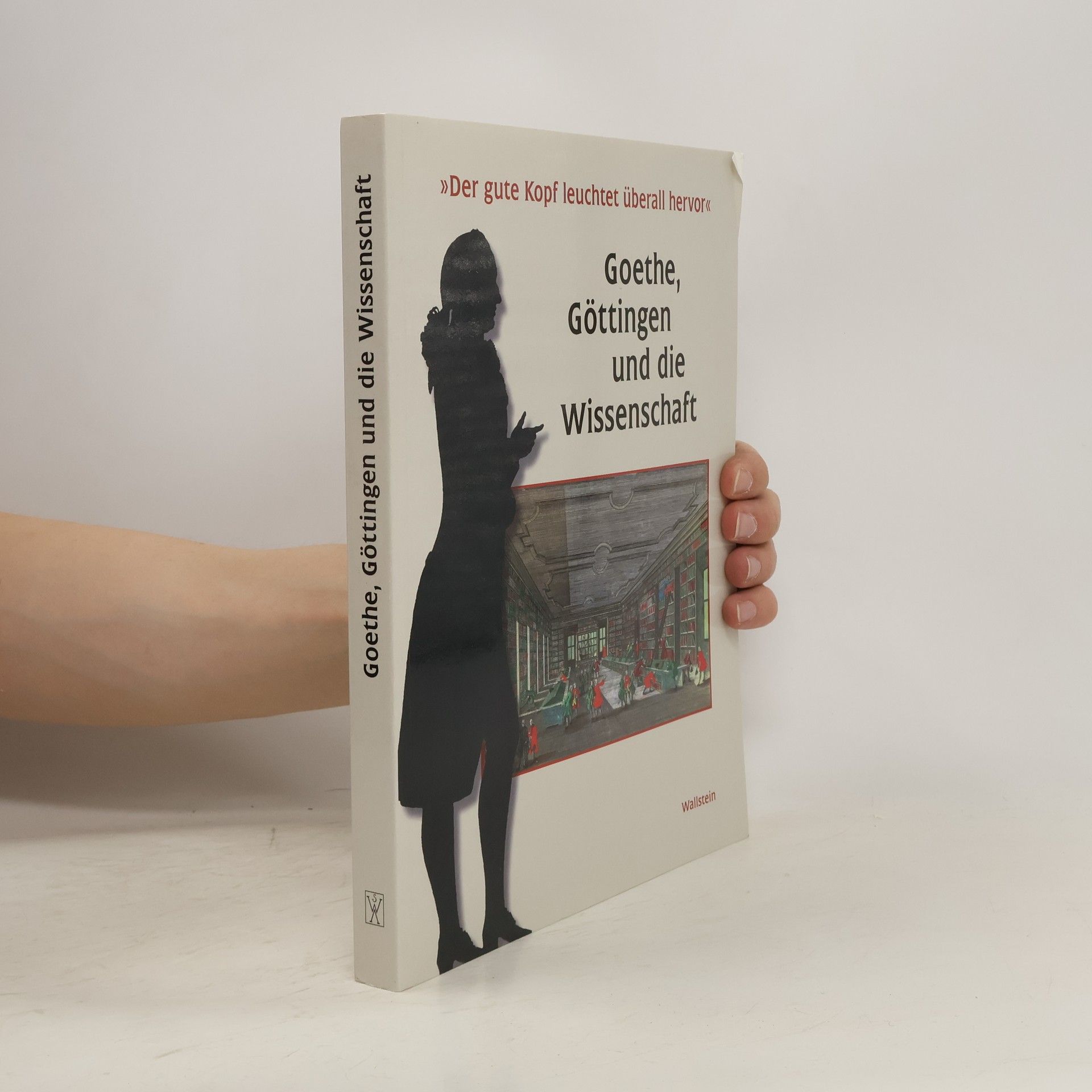
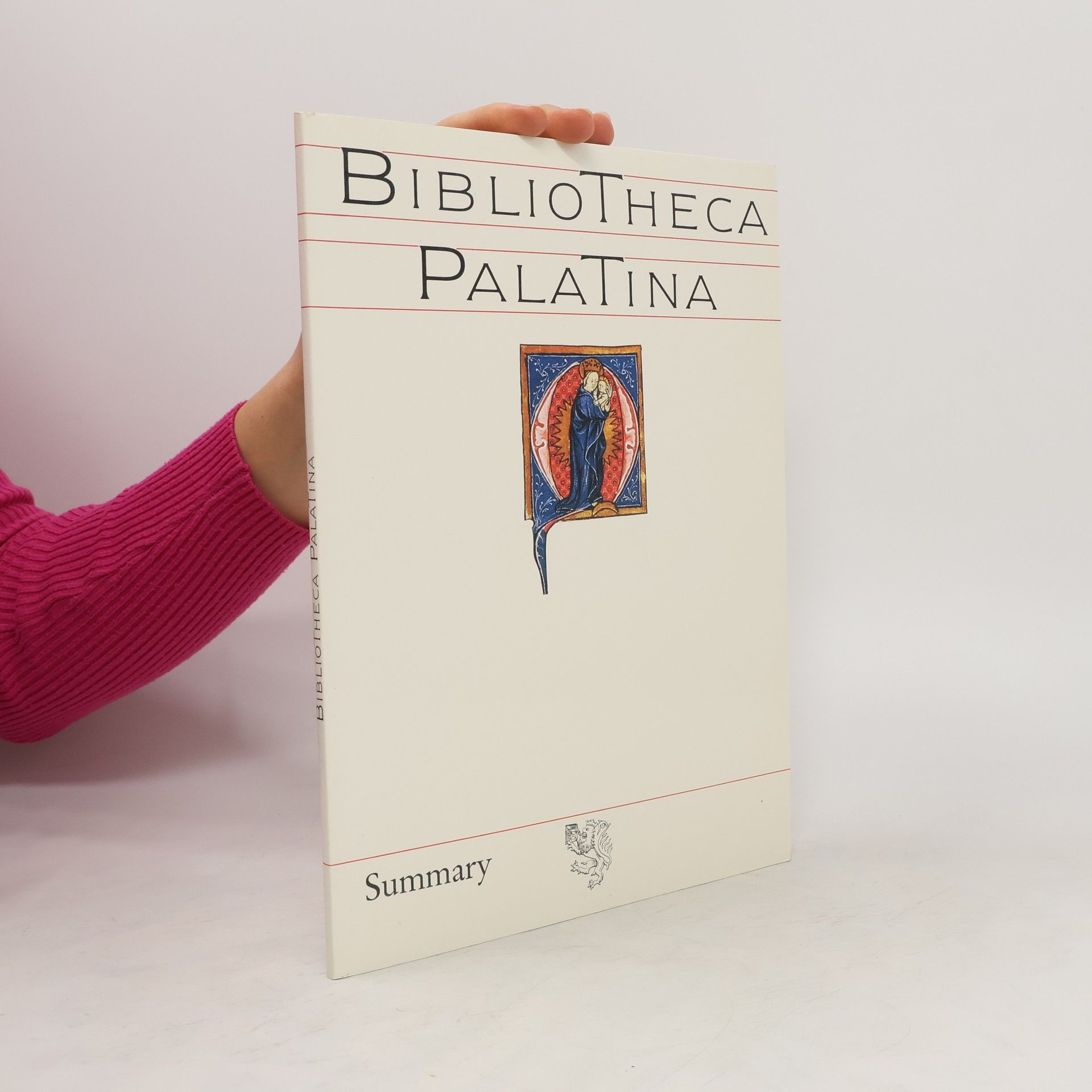
Der Ausstellungskatalog »Der gute Kopf leuchtet überall hervor » Goethe, Göttingen und die Wissenschaft« dokumentiert Goethes Besuche in der Universitätsstadt in den Jahren 1783 und 1801. Während dieser Besuche traf Goethe auf zahlreiche Göttinger Gelehrte wie Heyne, Schlözer, Blumenbach, Michaelis, Ossiander und Gmelin, die zeitlebens großen Einfluß auf sein Werk hatten. Er schwärmte: »Es ist gar angenehm, auf einem solchen Meere des Wissens, nach allen Gegenden mit Leichtigkeit hinsegeln zu können.« Sein Bemühen um Lichtenberg jedoch blieb auf Dauer vergeblich. Ihm schickte er im September 1793 sein Manuskript über die farbigen Schatten, zu dem Lichtenberg mehrdeutig bemerkte: »Der gute Kopf leuchtet überall hervor«. Über Goethes Farbenlehre schwieg sich der Göttinger Physiker und Philosoph standhaft aus - als Naturwissenschaftler blieb Goethe das Göttinger Gütesiegel versagt. Goethe besuchte den Botanischen Garten und das Akademische Museum mit seinen Sammlungen zu Völkerkunde, Kunstgeschichte, Zoologie und Geologie und nutzte Göttingens berühmte Bibliothek. Zahlreiche Abbildungen von außergewöhnlichen Exponaten wie der Mundurucu-Kopftrophäe und Originaldokumenten im Anhang belegen Höhen und Tiefen der Beziehung Goethes zu Göttingen, seinen Gelehrten und wissenschaftlichen Einrichtungen. Zu Goethe siehe auch: edition text+kritik