Dieses Lehrbuch bietet eine soziologische Perspektive auf Lebenslauf und Sozialisation, untersucht deren Zusammenhänge und die gesellschaftlichen Einflüsse auf individuelle Entwicklungsprozesse. Es beleuchtet die Entwicklung dieser Forschungsrichtung seit dem 20. Jahrhundert in den USA und weltweit.
Michael Corsten Boeken
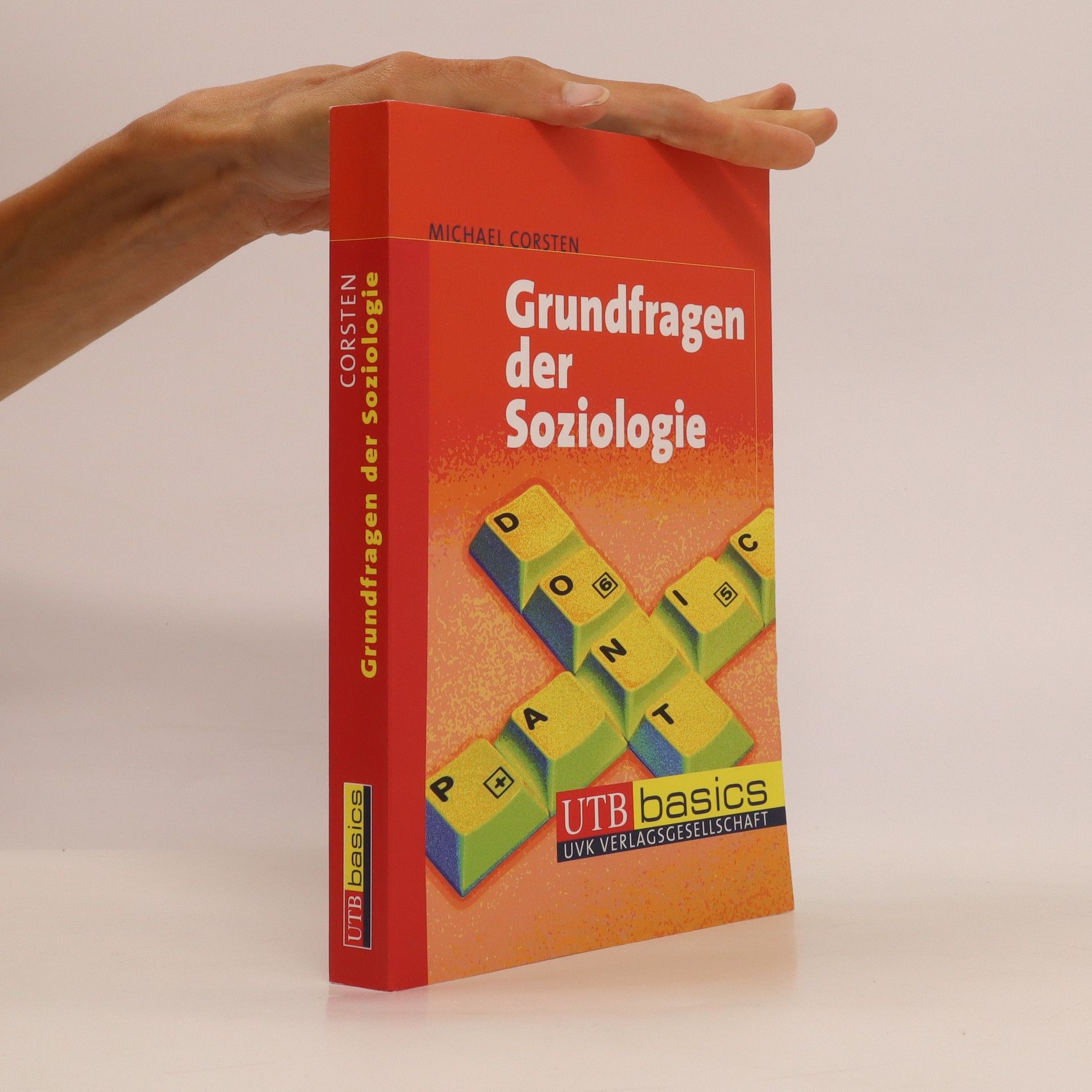



In der Schul- und Unterrichtsforschung haben sich mittlerweile eine ganze Reihe Themen gefunden, die mit videografischen Beobachtungsmethoden untersucht werden. Daraus folgen interessante Befunde, aber auch neue Fragen: Welche Chancen gehen mit audiovisuellen Daten für die Schul- und Unterrichtsforschung einher? Welche methodischen und theoretischen Tendenzen zeichnen sich hier ab? Sind dabei bestimmte Unterrichtsformen oder Fächer der Videoanalyse zugänglicher als andere? Der Band gibt einen Überblick zu den derzeit einschlägigen Forschungen. (Quelle: www.buch.ch
Eine Einführung in die Soziologie, die Vorstellungskraft und Urteilsvermögen für gesellschaftsanalytische Fragen wecken soll. Michael Corsten zeigt auf, wie durch Begriffe und Begriffsfelder unterschiedliche Perspektiven auf die grundlegenden Fragestellungen der Soziologie eröffnet werden. Er stellt Verbindungen zwischen verschiedenen Denkansätzen her, integriert spezielle Soziologien (wie z. B. Familien- oder Bildungsforschung) und vermittelt Einblicke in typische Kontroversen des Fachs.