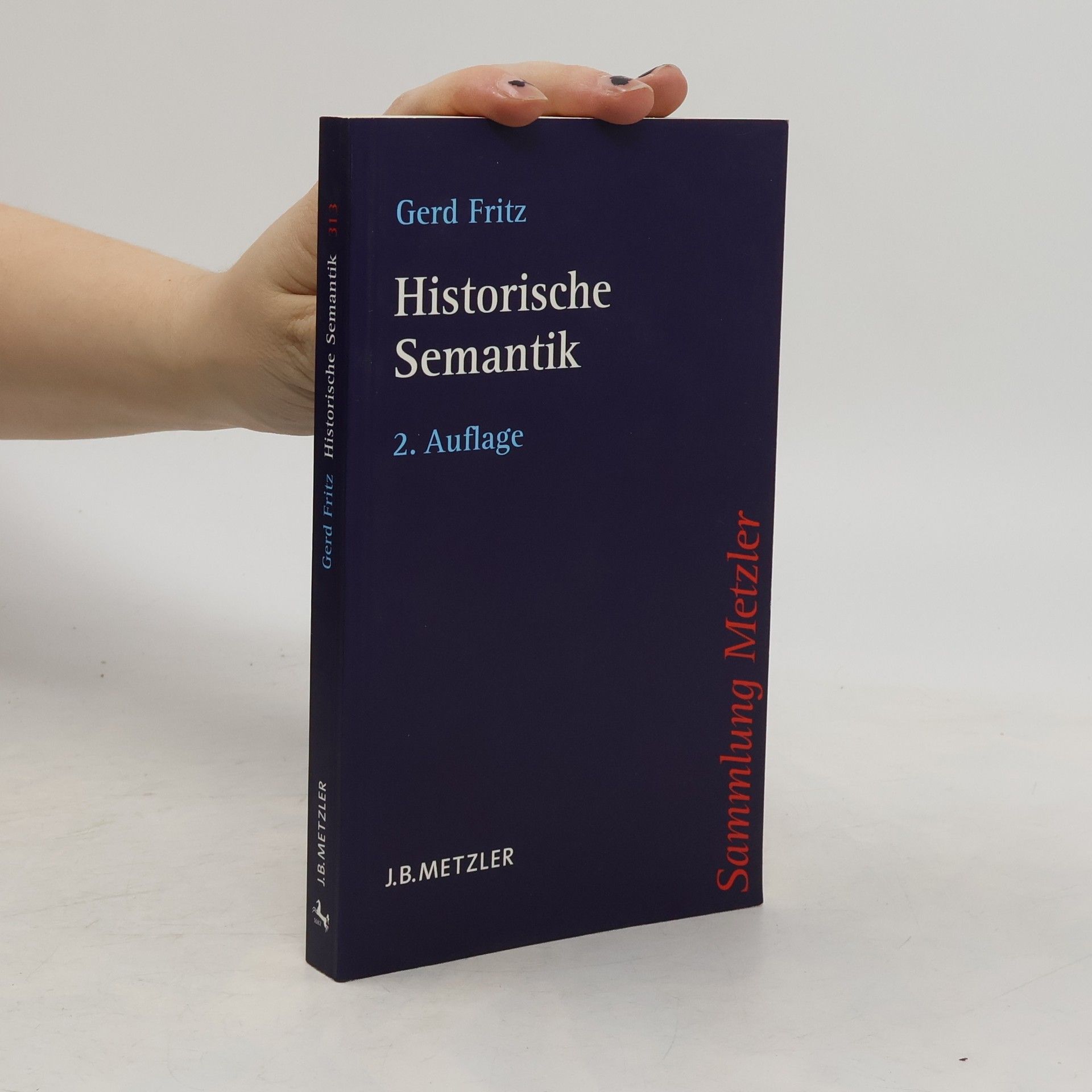Historische Semantik
- 197bladzijden
- 7 uur lezen
Zur Theorie der Bedeutungsentwicklung. Anhand von vielen Beispielen vom Althochdeutschen bis zur Gegenwart führt der Autor in die historische Semantik ein. Ausgewählte Analysen von Bedeutungsentwicklungen konkretisieren theoretische und methodische Fragen.