Oskar Anweiler Boeken
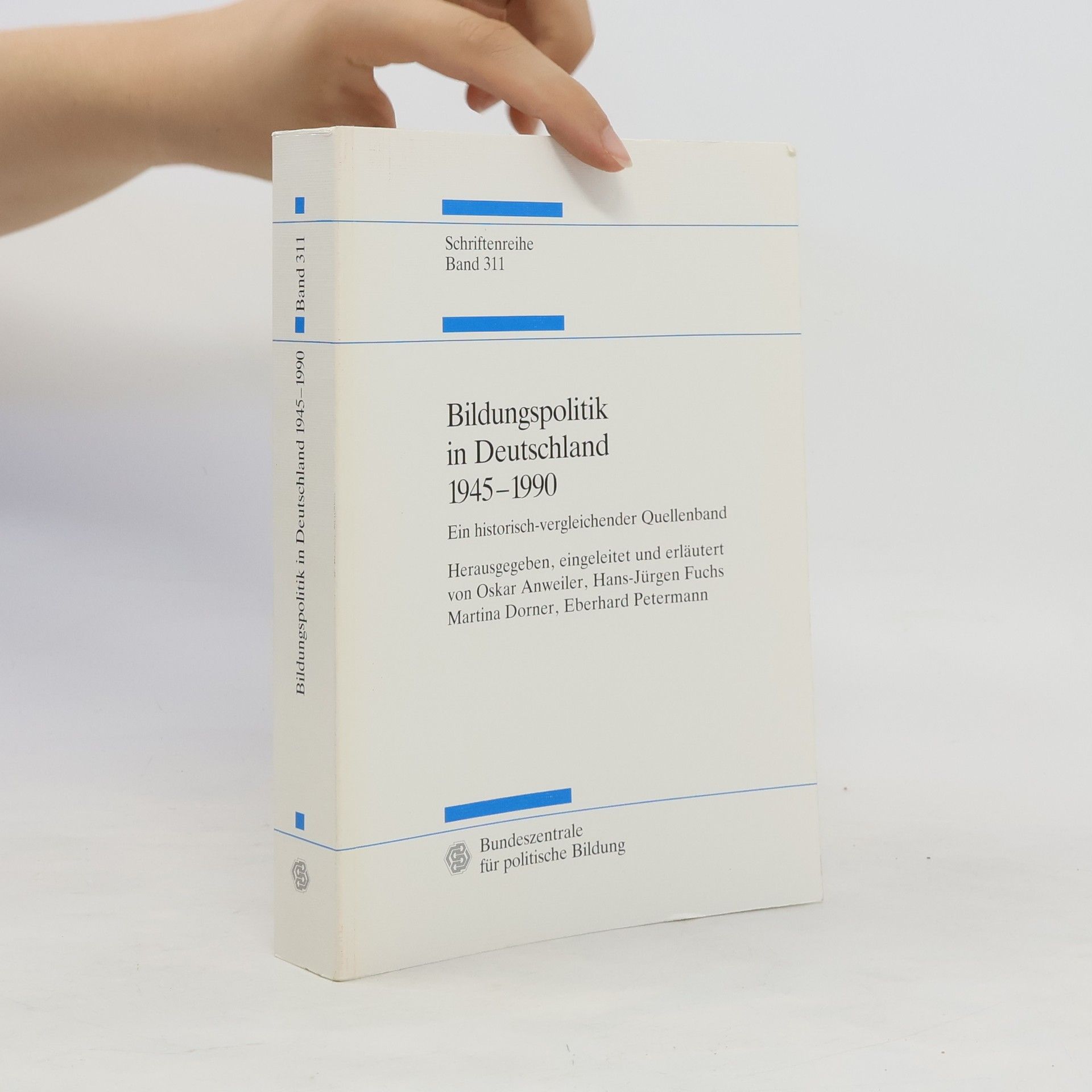
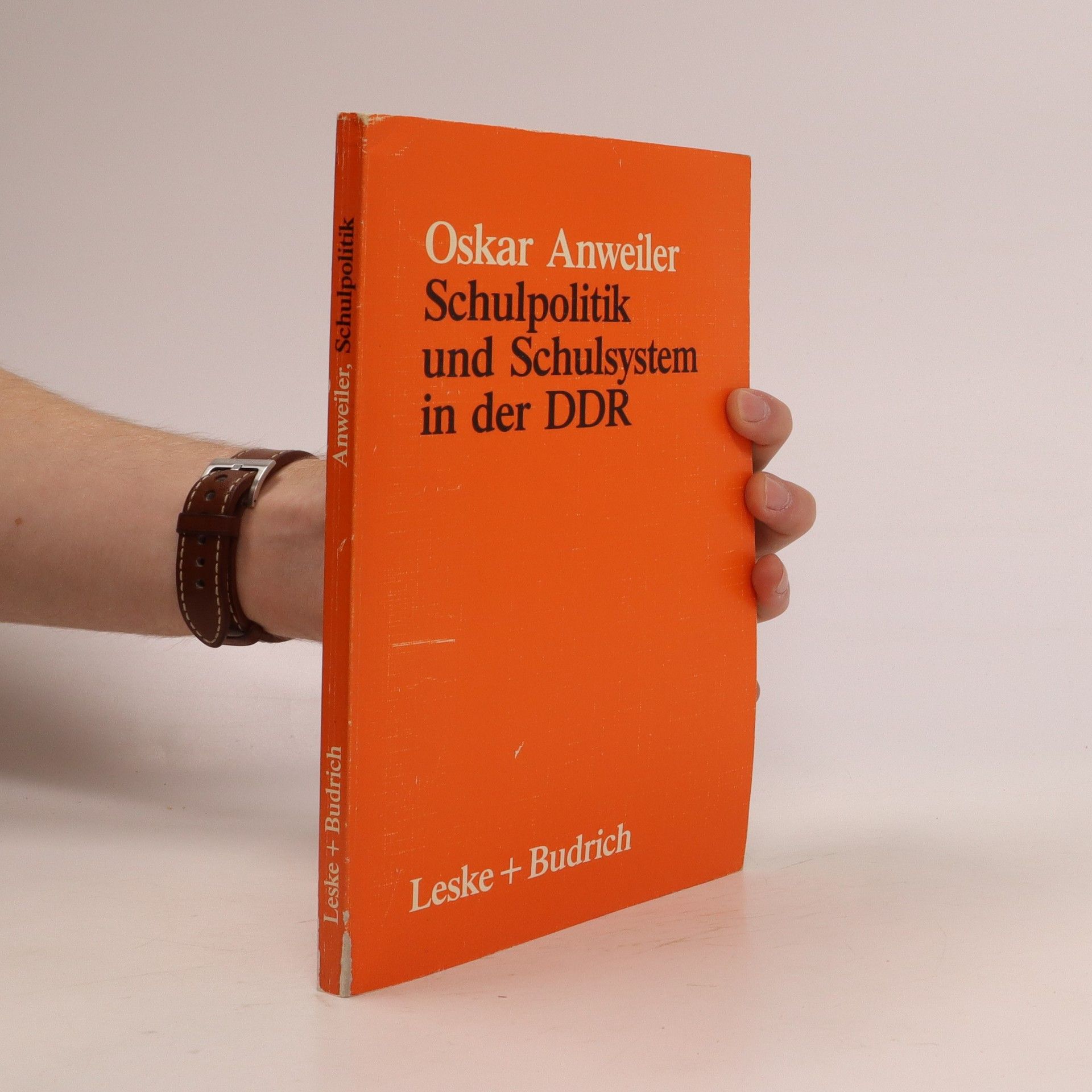

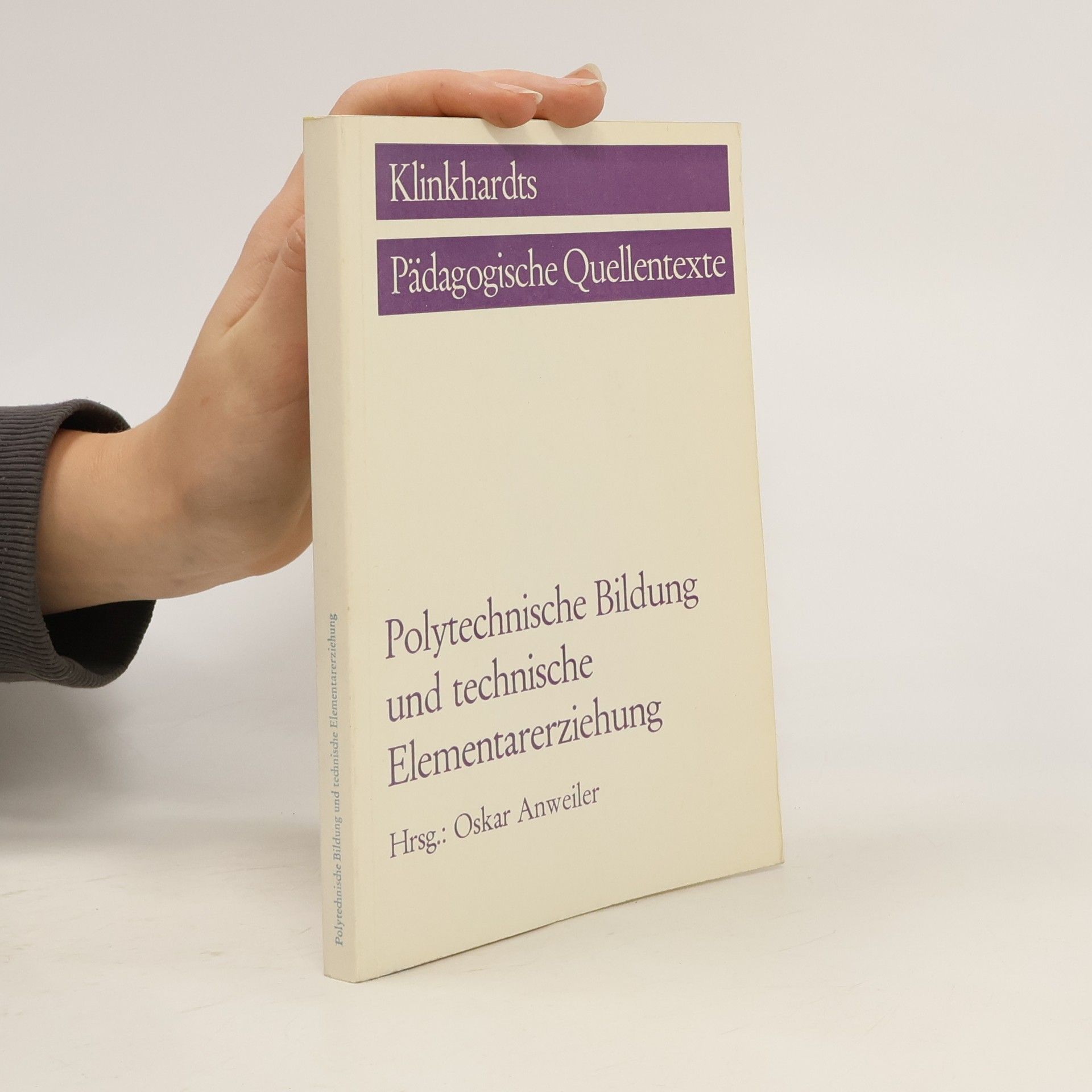
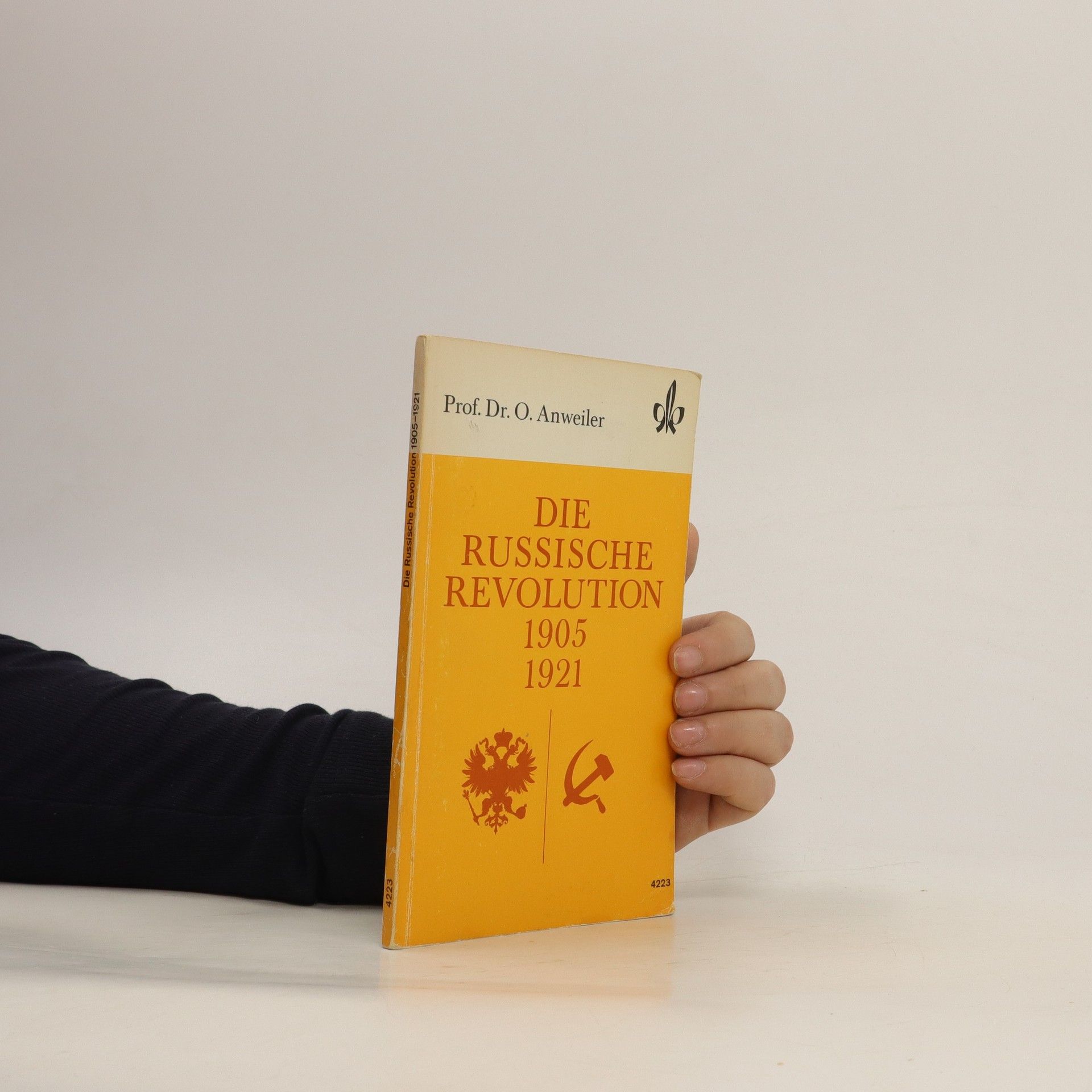
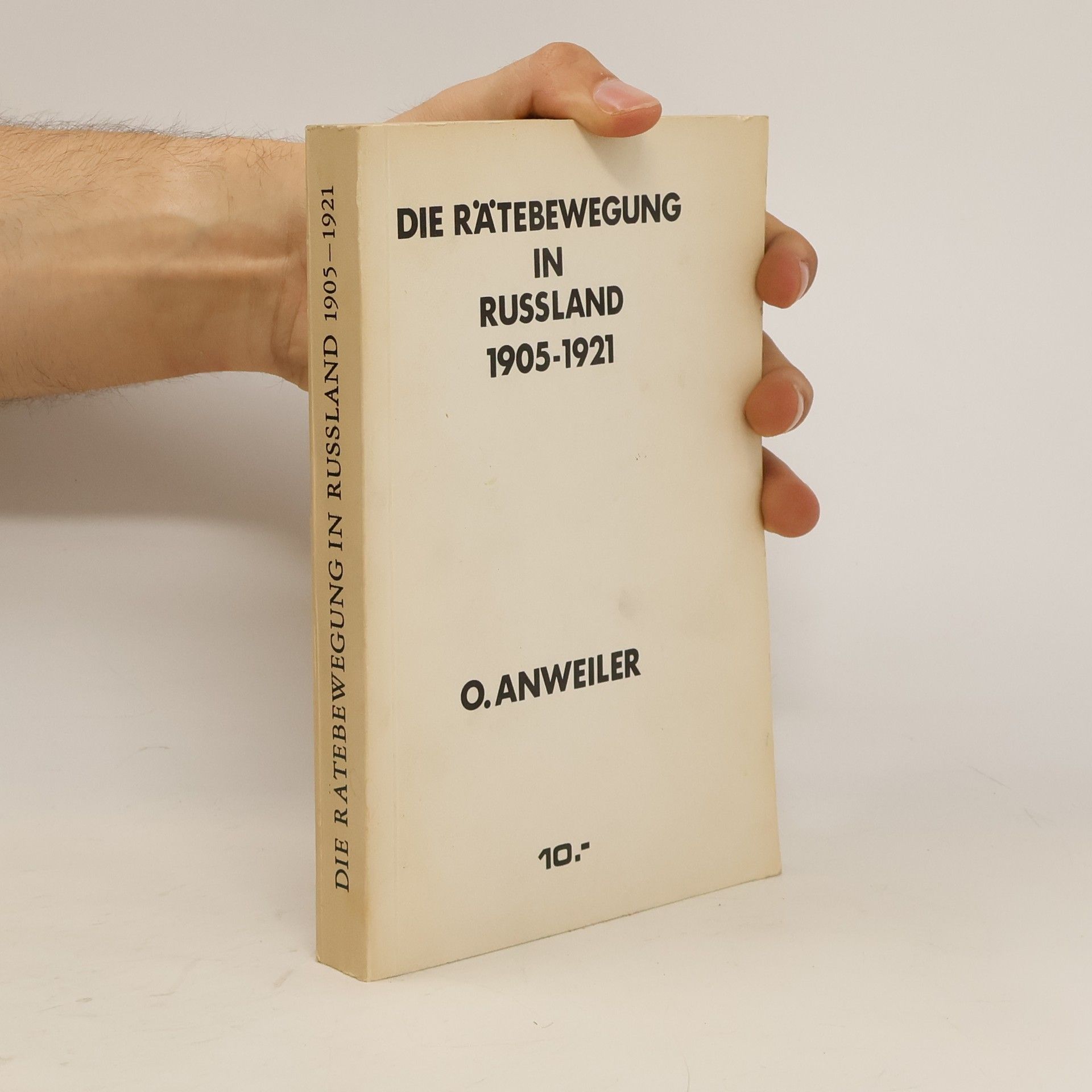
Schulpolitik und Schulsystem in der DDR
- 196bladzijden
- 7 uur lezen
Der deutschen Pädagogik ist mit oberflächlicher Polemik nicht gedient; vielmehr ist eine gründliche, sachkundige wissenschaftliche Diskussion notwendig, die sich nicht vor politischen Tatsachen und ideologischen Gegensätzen scheuen darf. Diese Erkenntnis aus der DDR-Zeitschrift „Pädagogik“ von 1957 ist nach wie vor relevant und spiegelt die Position des Verfassers wider. Wissenschaftliche Diskussionen finden leider immer noch zu selten im direkten Dialog oder öffentlichen Meinungsaustausch statt. Wenn sie stattfinden, sollten sie auf umfassender Sachkenntnis basieren und nichts beschönigen oder verschweigen. Dialogbereitschaft erfordert die Maßstäbe wissenschaftlicher Erkenntnis. Die vorliegende Darstellung der Schulpolitik und des Schulsystems in der Deutschen Demokratischen Republik richtet sich nicht nur an Spezialisten, sondern auch an Leser und insbesondere an Studenten, die sich mit dem Thema vertraut machen möchten. Die Forschungsergebnisse wurden so aufbereitet, dass grundlegende Informationen mit einer Problemanalyse verbunden sind. Erfahrungen und Anregungen aus über zwanzig Jahren in Vorlesungen und Seminaren sowie Ergebnisse früherer Untersuchungen fließen ebenfalls ein. Ein besonderer Dank gilt der Stiftung Volkswagenwerk für die Unterstützung bei der Fertigstellung des Manuskripts.