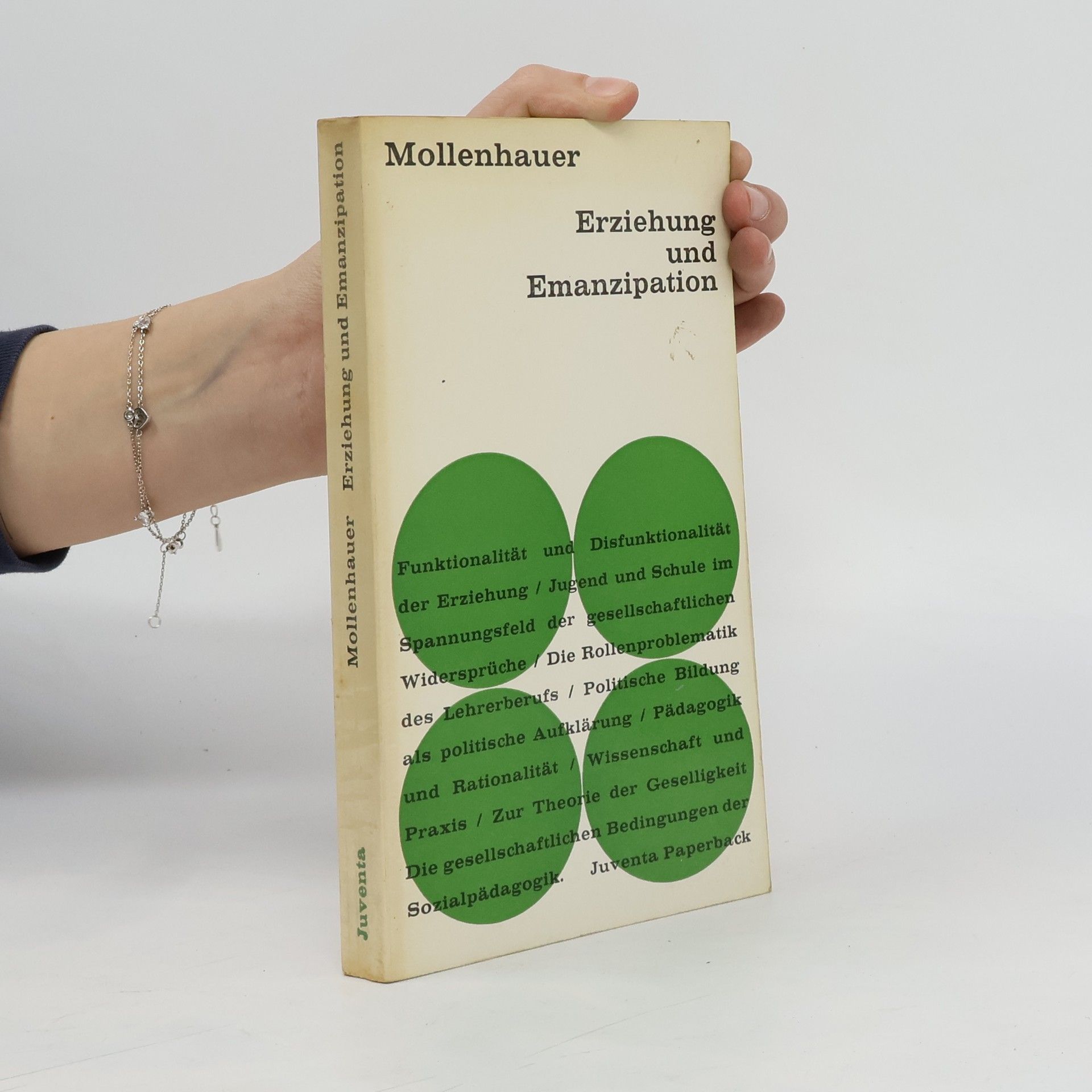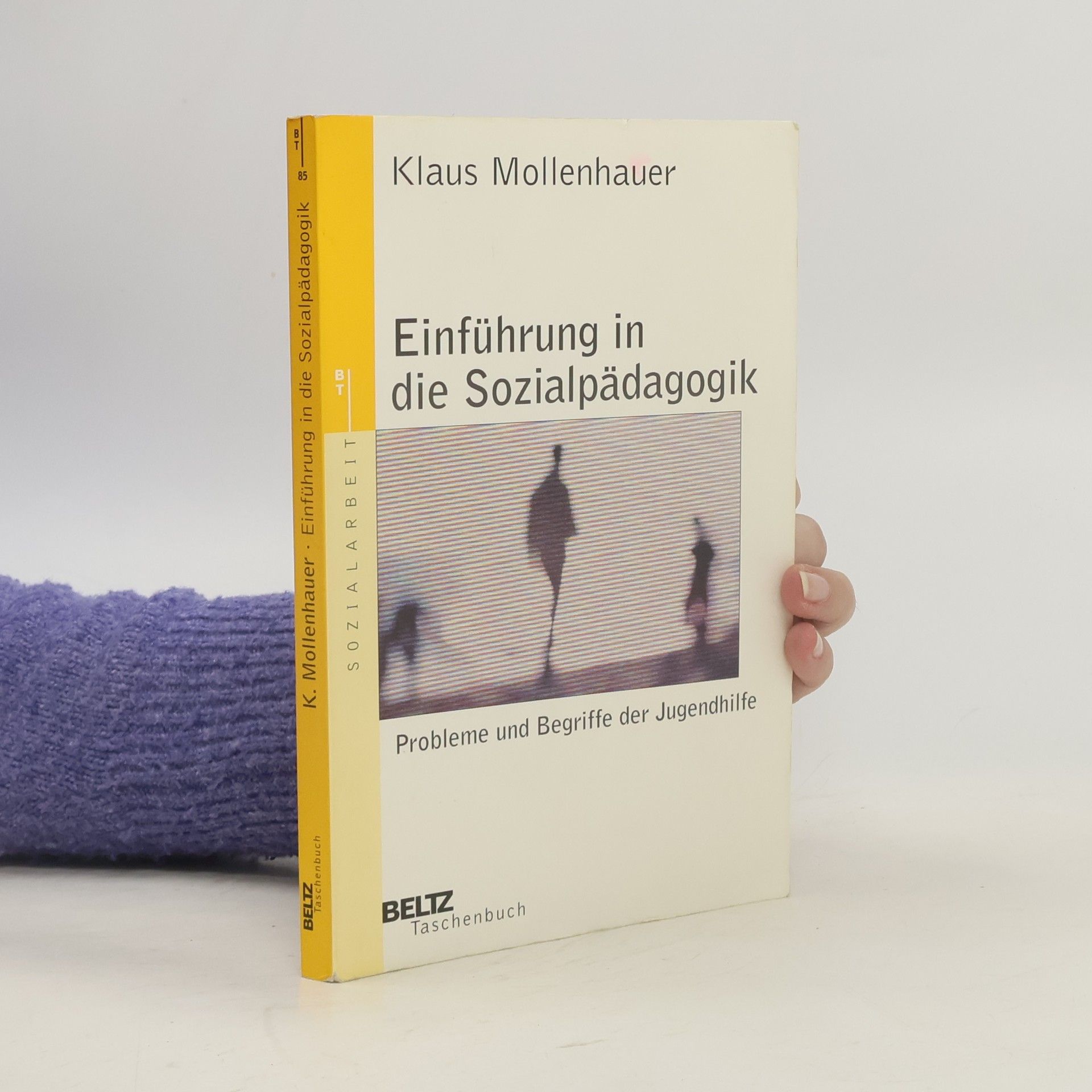Grundfragen ästhetischer Bildung
- 320bladzijden
- 12 uur lezen
Über ästhetische Bildung wird seit je viel geschrieben. Das empirische Wissen über das, was ihr zugrunde liegt, ist indessen gering. In den hier vorgelegten Untersuchungen und Interpretationen wird der Stand der Diskussion in Kunst- und Musikwissenschaft herangezogen, allerdings nicht im Sinne allgemeiner „Aisthesis“-Annahmen, sondern mit Bezug auf die „Kunstförmigkeit“ der kindlichen Produktion. Das empirische Material dieser Untersuchung besteht aus Bildern und musikalischen Improvisationen. Erstmalig werden bildnerische und musikalische Erfahrung gleichgewichtig behandelt. In zehn Kapiteln werden die Komponenten des reichhaltigen Spektrums ästhetischer Erfahrungen (Mimesis, Interaktion, Stil, Gestalt, Ausdruck) theoretisch erläutert und an den Produkten nachgewiesen. Das Material wird in 150 Farbtafeln und 90 Notenbeispielen präsentiert. So erfüllt die Untersuchung drei Funktionen: Sie ist in der Aufeinanderfolge der Kapiteleinführungen eine theoretische Darlegung der Grundlagen ästhetischer Bildung; sie ist ein Anschauungsbuch für die Vielfalt ästhetischer Hervorbringungen von Kindern, auch für das, was häufig Kreativität genannt wird; und sie ist Anlass und Anregung für weitere empirische Arbeit in diesem Problemfeld, gerade auch durch die Differenzen, die sich gegenüber gängigen theoretischen Orientierungen auftun.