Faust : Part I.
- 320bladzijden
- 12 uur lezen
The translation of American poet Randall Jarrell of Faust, Part One. The photograph of the cover here is incorrect, as it shows the front of a WW Norton edition.
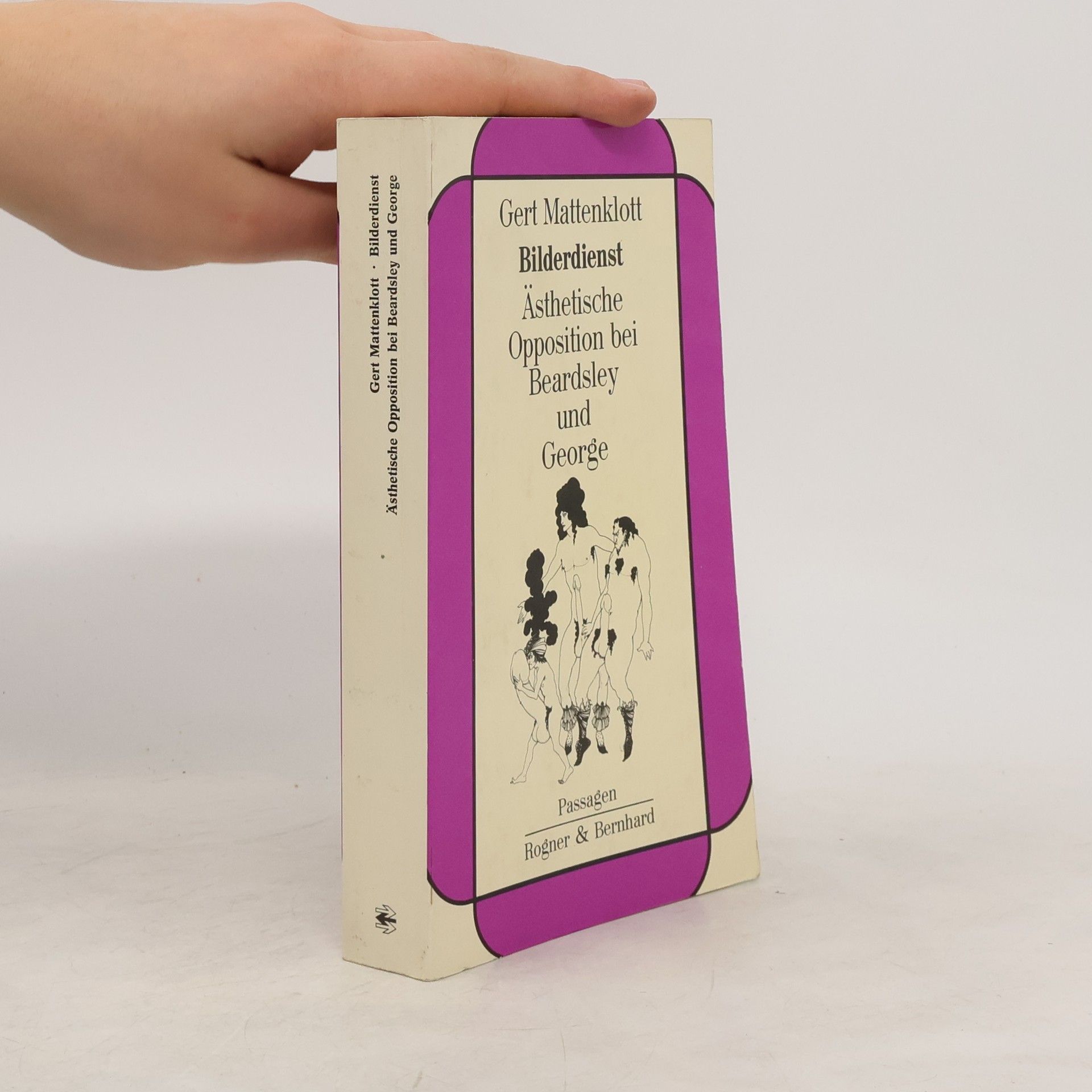


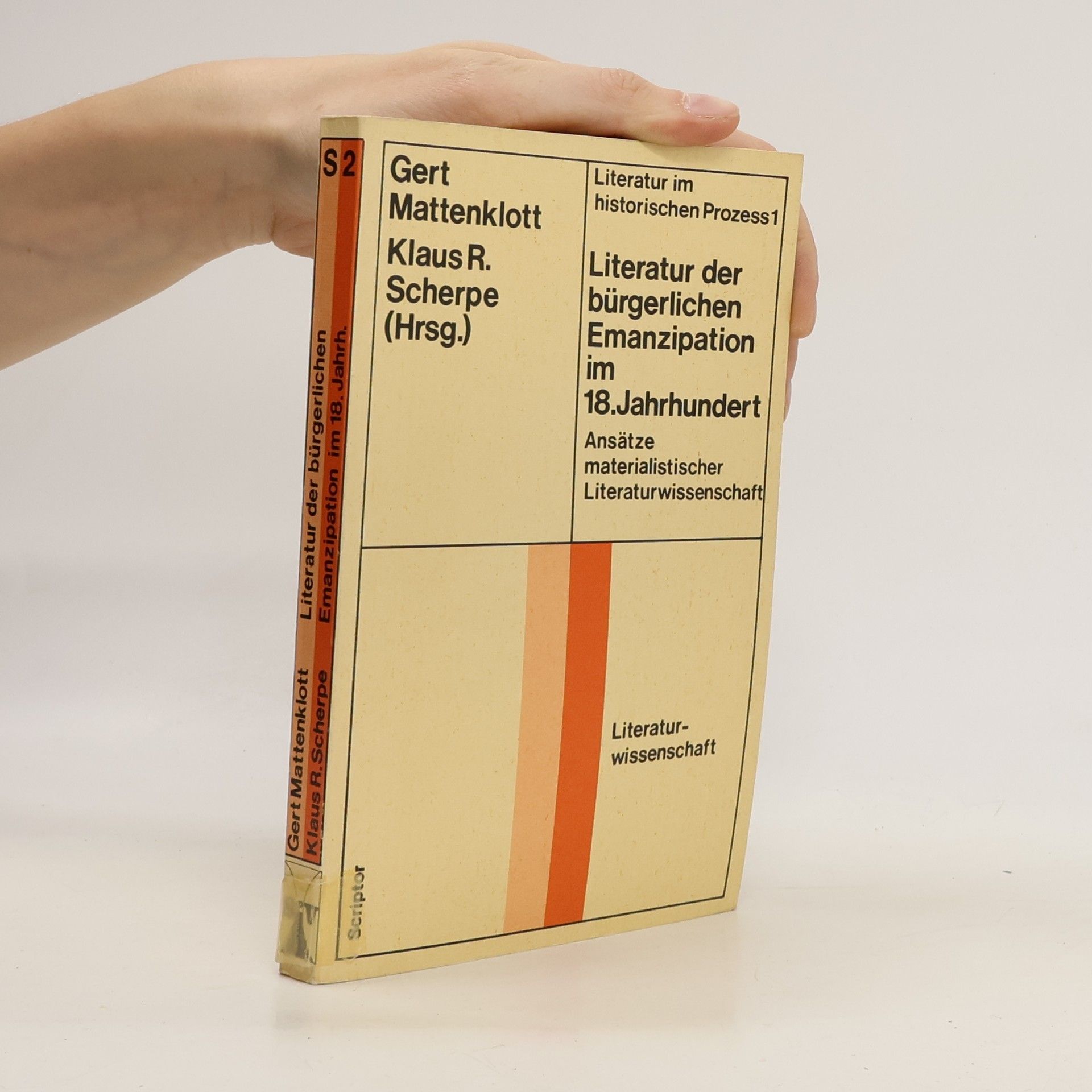

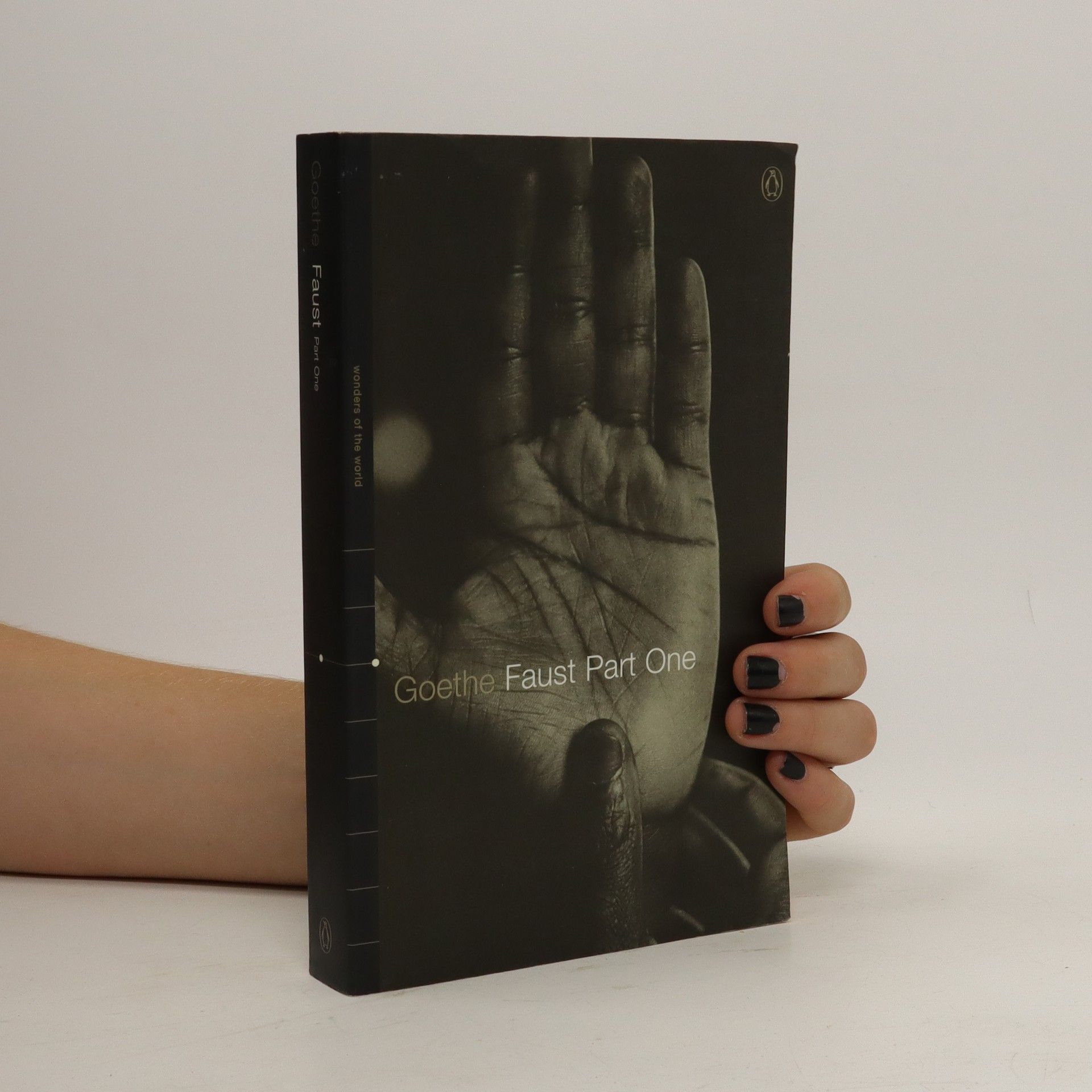
The translation of American poet Randall Jarrell of Faust, Part One. The photograph of the cover here is incorrect, as it shows the front of a WW Norton edition.
Das Eintreffen des Ästhetischen ist für viele Menschen unwahrscheinlich, da zweckloses Tätigsein in ihrem Alltag nicht vorgesehen ist. Die einflussreichen Essays des Komparatisten Gert Mattenklott erschließen ästhetisches Handeln als ein Ereignis, das in der Spannung zwischen Ästhetik und Politik stattfindet. Dieses Handeln wird als eigensinnige Opposition gegen die Verhältnisse konturiert, die es begrenzen und die Formen der hervorgebrachten Objekte prägen. Der Reiz dieser Essays liegt in ihrer formalen Gestalt; sie navigieren metaphorisch durch den Raum zwischen Politik und Kunst und inszenieren ein Verstehen jenseits wissenschaftlicher Begriffe. Im Nachvollzug der ästhetischen Erfahrung wird diese als eine letztlich unbeendbare Reflexionsbewegung zwischen Objekten und einem konkreten Subjekt dargestellt. Die über vier Jahrzehnte hinweg entstandenen Arbeiten überschreiten das Feld der Literatur und tragen zu einer anthropologisch fundierten Ästhetik bei, die die natürliche Fähigkeit des Menschen in den Mittelpunkt stellt, seine Kräfte frei zu entfalten. Dadurch wird angestrebt, Politik und Ästhetik nicht mehr als Opposition zu denken, sondern als miteinander verbundene Bereiche, die zur Erneuerung der Welt beitragen.
August von Platen. Hrsg. von Gert Mattenklott u. Hansgeorg Schmidt-Bergmann 1988 210 S. Taschenbuch Athena?um,
Blindgänger versammelt folglich Versuche über ein Phantom mit verschiedenen Gesichtern, das unter- und außerhalb der repräsentativen Kultur sein Unwesen treibt: Faulheit, Geilheit und Zerstreutheit, Albernheit, Sentimentalität und Epigonalität heißen einige seiner Namen; einige kommen in diesem Buch zu Wort, das in der Tradition der Physiognomik typische Charaktere des 19. und 20. Jahrhunderts modelliert.