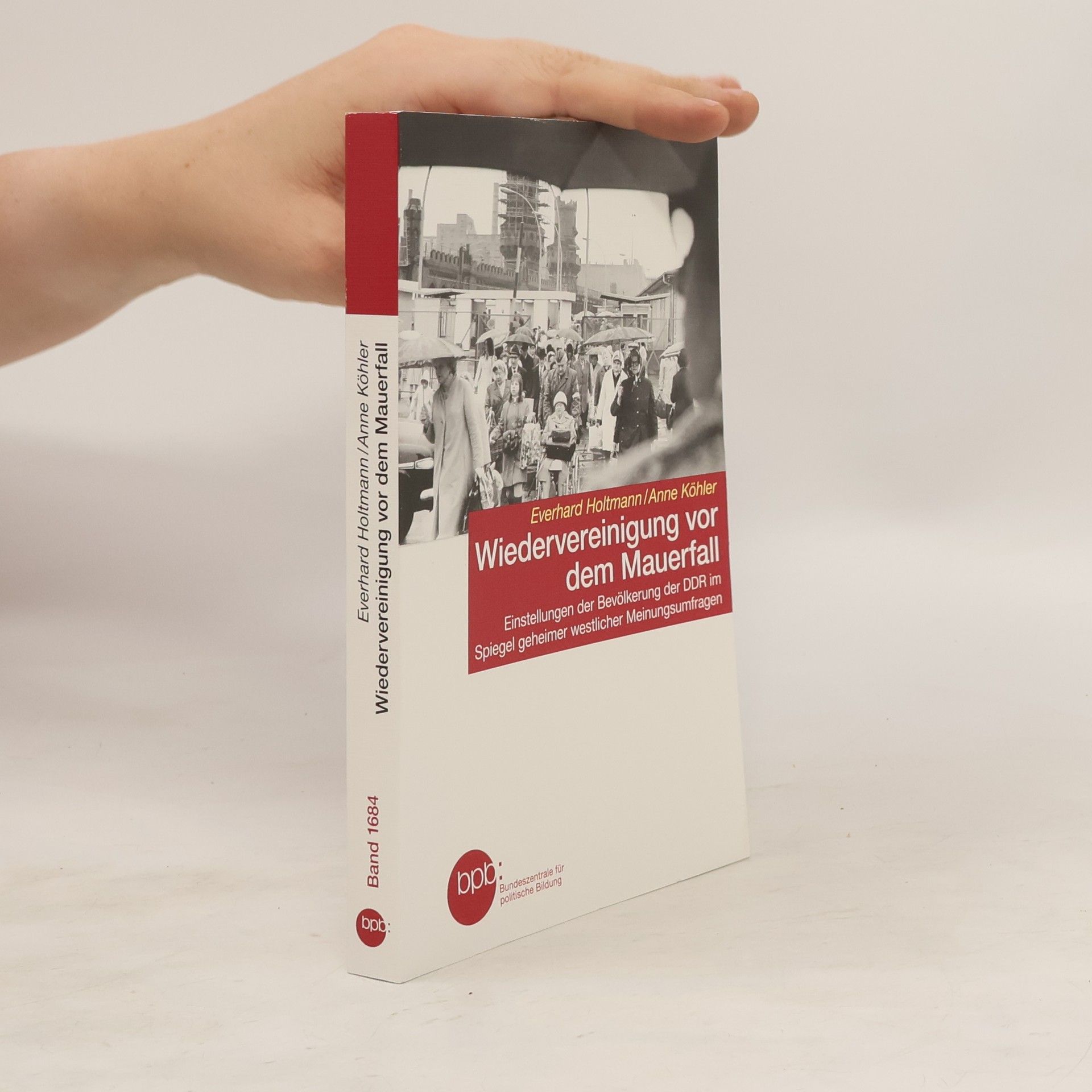Populismus wird in dieser Studie als ein Muster der politischen Kommunikation beschrieben, das bei den angesprochenen Personen sowohl betäubende als auch berauschende Wirkungen erzeugt, und potenziell süchtig macht. Die Anfälligkeit der Gesellschaft für populistische Ansätze ist groß, was Politiker aller Parteien dazu verleitet, populistisch zu agieren. Dies gilt auch für Deutschland, wo die starke Wirkung populistisch aufbereiteter Politik eine Belastung für die Demokratie darstellt. Populisten wecken gezielt Ressentiments und schüren Vorurteile, während sie Probleme dramatisieren. Ängste und Aggressionen behindern eine differenzierte Wahrnehmung komplexer Sachverhalte, was die Grundlage einer demokratischen politischen Kultur gefährdet. Populismus steht im krassen Gegensatz zur politischen Aufklärung. In der Studie werden charakteristische Stereotypen des Populismus kritisch betrachtet. Dies geschieht in zwei Schritten: Zunächst wird das populistische Stereotyp präsentiert und eingeordnet, gefolgt von dessen Gegenüberstellung mit der Realität. Dadurch wird deutlich, wie Populisten die Wirklichkeit verzerren und wie das populistische Stereotyp als Zerrbild fungiert. Diese Untersuchung wurde von Bernd Lüdkemeier und Wilfried Welz von der Landeszentrale für politische Bildung des Landes Sachsen-Anhalt angeregt und begleitet, unterstützt durch Rebecca Plassa und Dennis Richter vom Institut für Politikwissenschaft der Martin-Luth
Everhard Holtmann Boeken



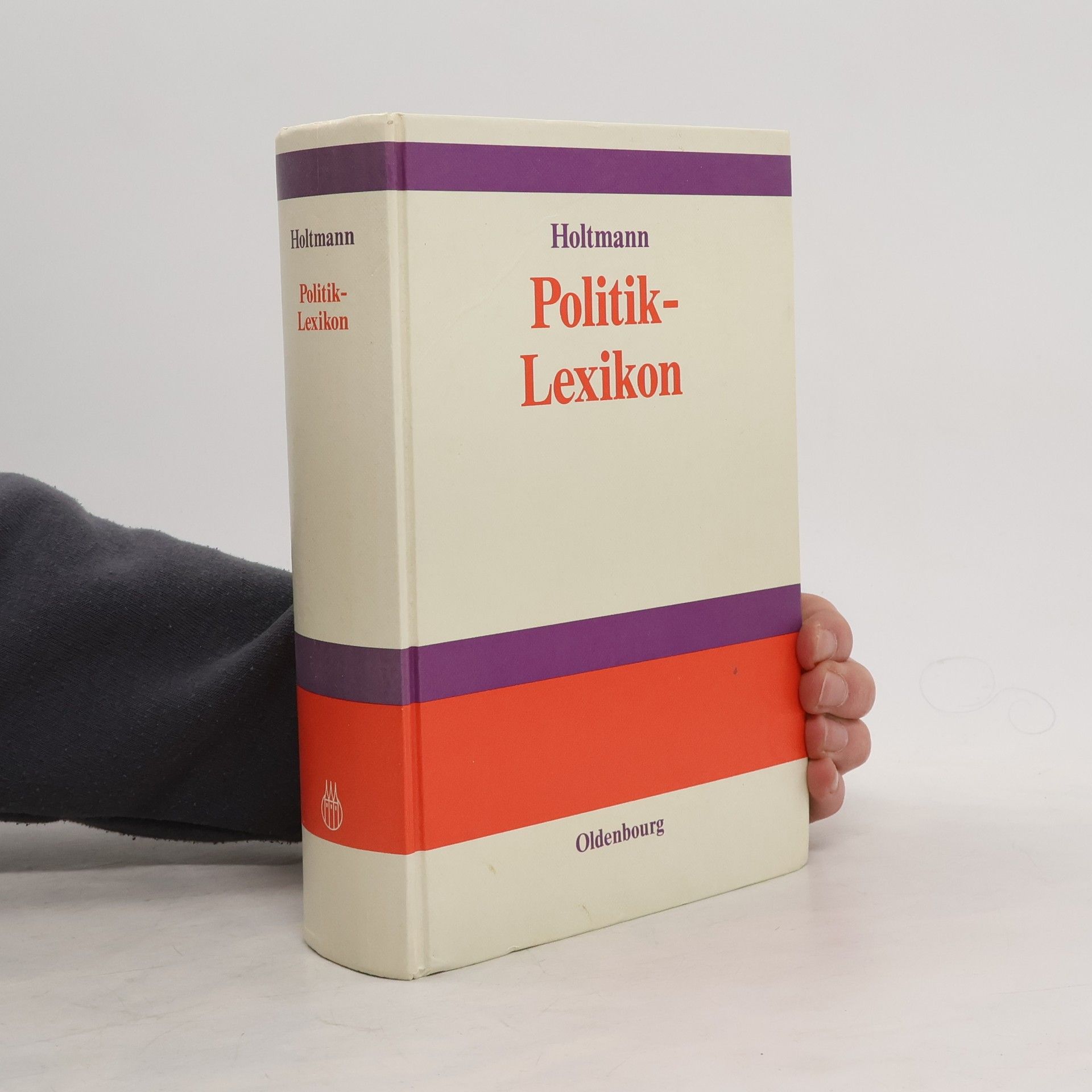
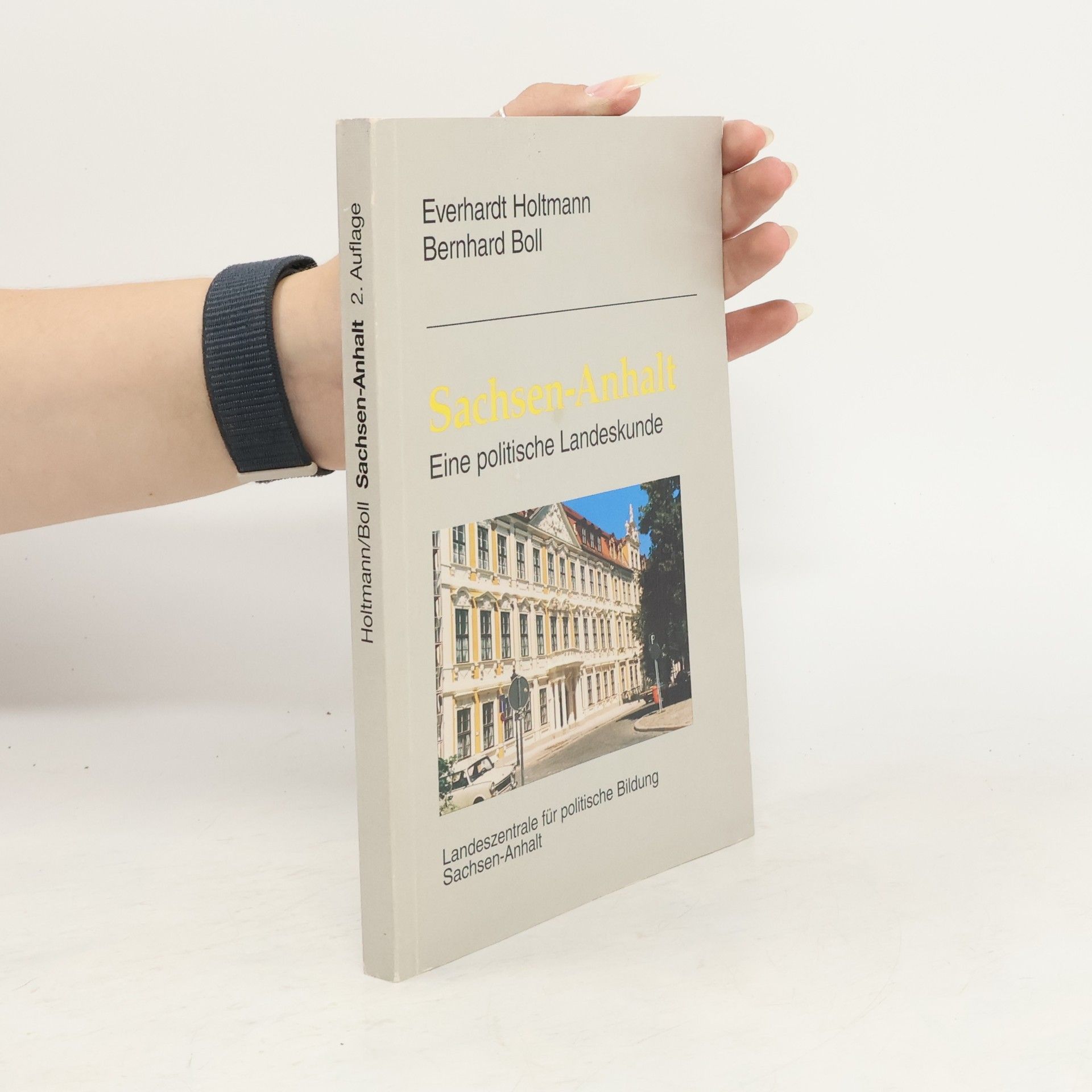

Politik-Lexikon
- 726bladzijden
- 26 uur lezen
Das Politik-Lexikon informiert knapp und präzise über Begriffe und Sachverhalte, Grundfragen und Problemlagen, Akteure, Institutionen, Handlungsformen und Erklärungsansätze gegenwärtiger Politik. Sachinformationen über das politische System der Bundesrepublik Deutschland bilden seinen Schwerpunkt. Auch die inter- und transnationalen Dimensionen der Politik sind einbezogen.
Dieses Open-Access-Buch bringt die Daten des Deutschen Freiwilligensurveys 2019 für einen Vergleich der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen zusammen. Der Freiwilligensurvey wurde 2019 zum fünften Mal im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) durchgeführt. Die Ziele der vorliegenden Auswertung sind eine aktuelle Bestandsaufnahme des freiwilligen Engagements und weiterer Formen zivilgesellschaftlichen Handelns in den einzelnen Bundesländern sowie eine Darstellung zentraler Entwicklungen im Zeitverlauf seit 1999. Des Weiteren wurden erstmals landesspezifische Charakteristika und die individuellen Kontexte und Umfeldbedingungen von freiwilligen Engagement analysiert.
Die Umdeutung der Demokratie
Politische Partizipation in Ost- und Westdeutschland
Der Plot erinnert an einen Spionageroman aus der Zeit des Kalten Zwischen 1968 und 1989 befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest im Auftrag des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen westdeutsche Besucher der DDR jährlich über die Stimmungen und Einstellungen der Bevölkerung im "sozialistischen Staat der Arbeiter und Bauern". Die seinerzeit vertraulich behandelten Erhebungen enthalten Aussagen darüber, wie die Bürgerinnen und Bürger der DDR ihre Lebensbedingungen, den ökonomischen Zustand ihres Staatswesens und ihre Freiheitsspielräume einschätzten. Die Umfragen bilden die damaligen Urteile Ostdeutscher zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bemerkenswert realitätsnah ab. Daher sind die unter einer "demoskopischen Tarnkappe" gemachten Beobachtungen eine einzigartige zeitgeschichtliche Quelle. Entstanden in Zeiten der Existenz zweier deutscher Staaten, stellen die Berichte zugleich ein Stück Vorgeschichte der deutschen Einheit dar.