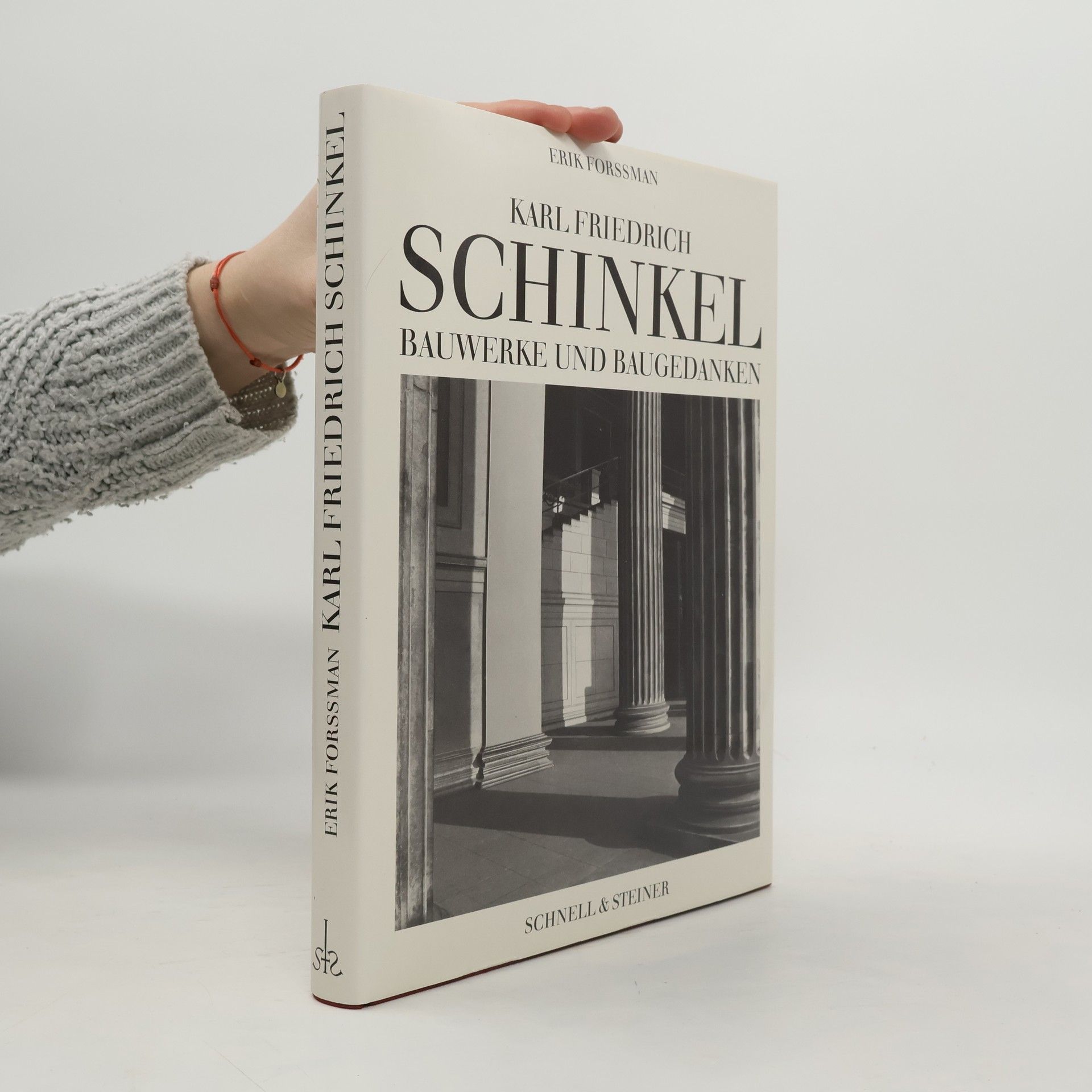Der Begriff »Goethezeit« wird vielfach unreflektiert gebraucht und von manchen Literatur- und Kunsthistorikern überhaupt abgelehnt. Sie ziehen es vor, das Zeitalter in verschiedene Perioden zu unterteilen und je nach Interessenlage von Aufklärung, Klassizismus, Revolutionskunst, Romantik, Neugotik, Historismus etc. zu sprechen. Der Verfasser möchte die Goethezeit vom Standpunkt des Kunsthistorikers aus noch einmal neu definieren und sie als eine zusammenhängende Epoche der deutschen Geistes- und Kunstgeschichte verstehen.
Erik Forssman Boeken
27 december 1915 – 17 juni 2011