Rudolf Heinz Boeken

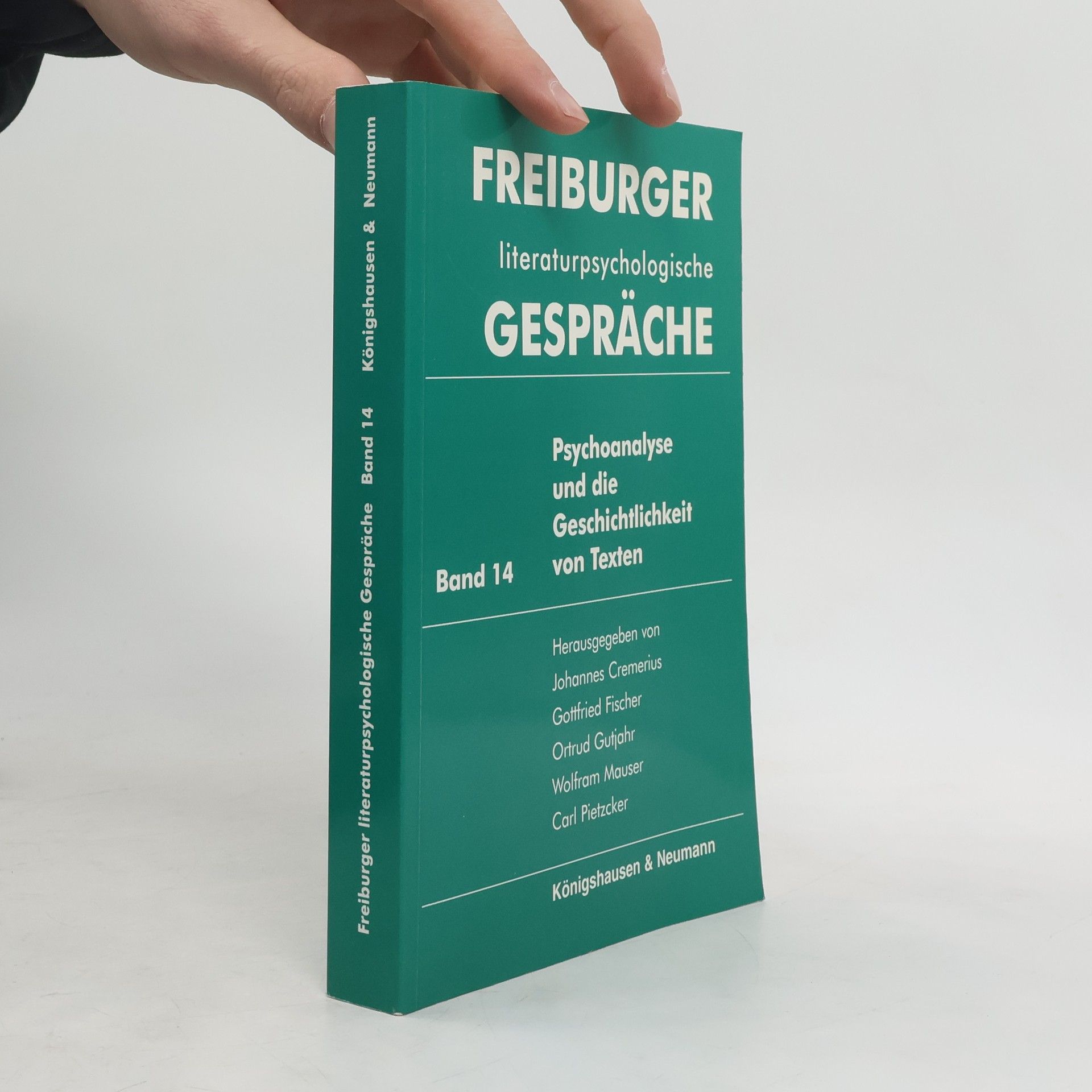
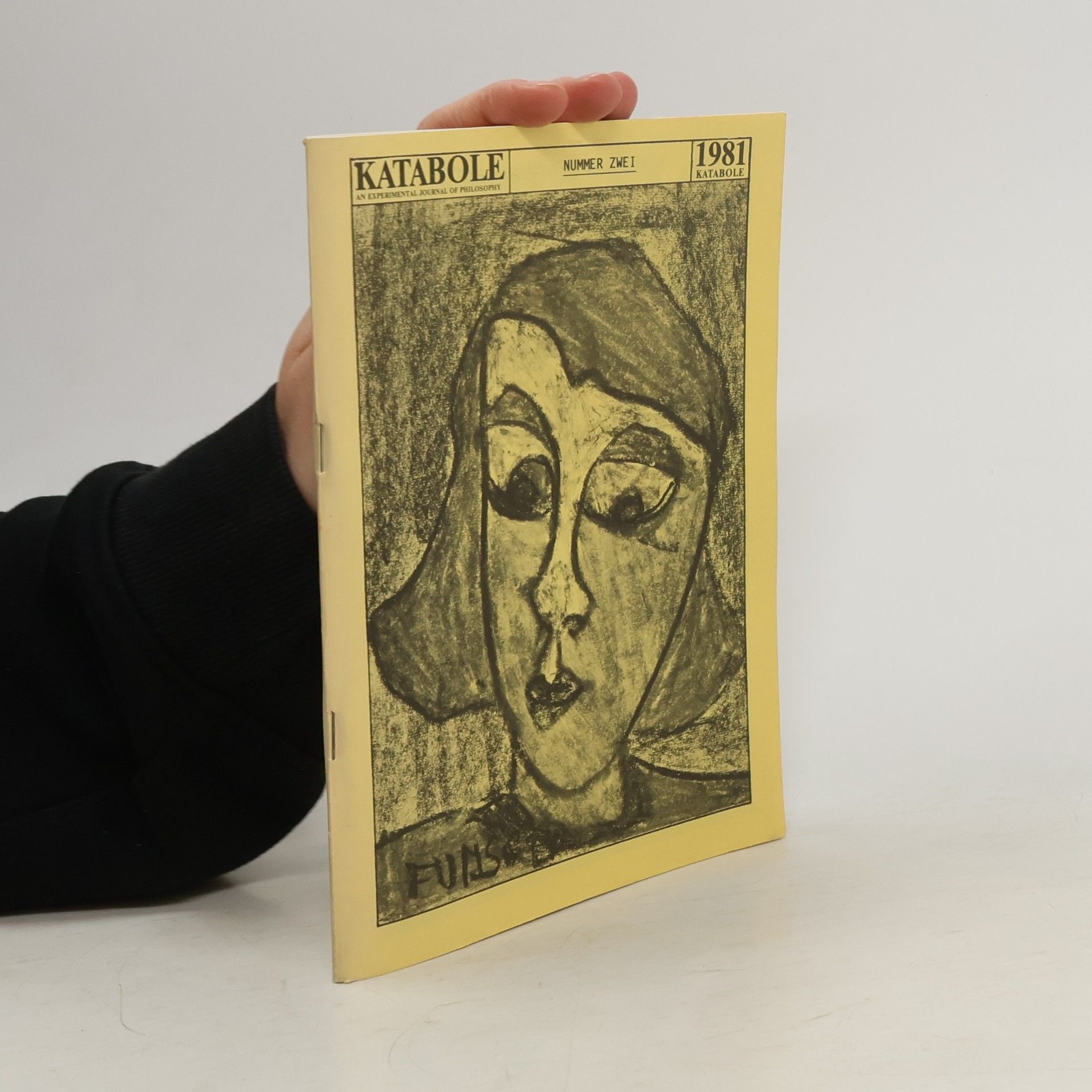

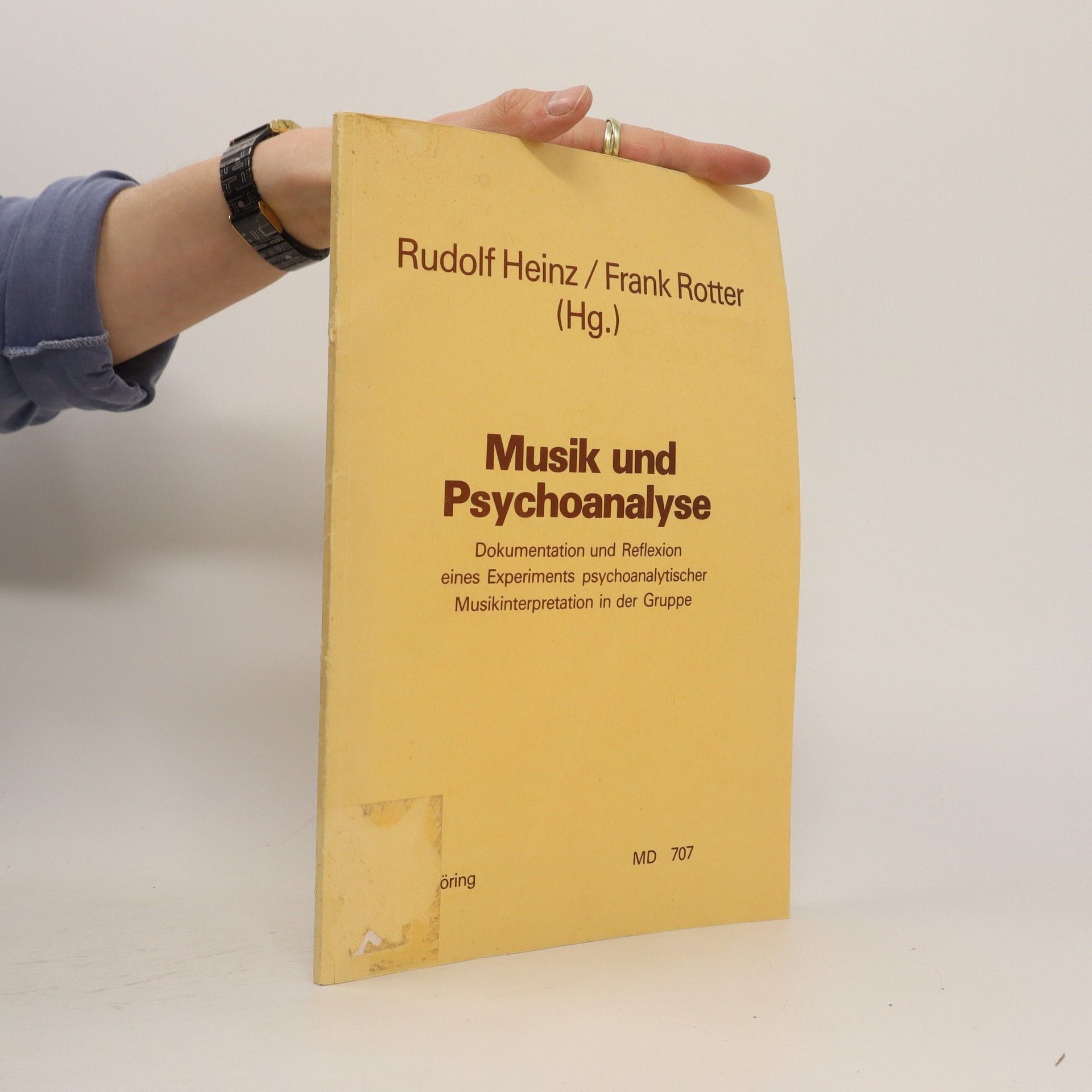

Abermals ansteht die Retrospektive der kritischen Sichtung des überkommenen Intersubjektivismus der Psychoanalyse – derzeit schwächelnd eingelassen in die dispositionsbegierigen medialen Proliferationen –, durchbrochen mittels der späten Freudschen Triebversion, des „Todestriebs“, die universelle Gewaltmimesis des vorgestellten Todes, überleitend in die objektivitätsekstatische Ausweitung der Psychoanalyse, kurzum zu einer „Psychoanalyse der Sachen“ (Sartre). Und dies nicht ohne Seitenblick auf die strapaziöse Vor- und Frühgeschichte dieser pathognostisch geheißenen kriterialen Wendung. Weitaus über bloße Duldung hinaus, bewerkstelligt August Ruhs in seinen Wiener Gründungen „Neue Wiener Gruppe / Lacan-Schule“ und „Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse“ – in denen ich jeweils dankbar Mitglied geworden bin – die volle Anerkennung solcher Psychoanalysekrisis. Weiterer entscheidender Problemschwerpunkt die pathognostische Traumphilosophie, eingebracht in Hans Ulrich Recks „Traum. Enzyklopädie“, München. Wilhelm Fink. 2010. 243 ff, allzeit in Rekurs auf Herbert Silberers „funktionales Phänomen / Autosymbolismus“, also die „Selbstreferenzialität“, weiland die „Absolutheit“; nutzbar auch als Interpretament der Exegese ausgewählter Bildender Kunst. Nicht fehlen darf der Hinweis auf unsere Anstrengungen der Etablierung pathognostischer Praxis, dargetan durch Kasuistik in einer Supervisionsgruppe.
German