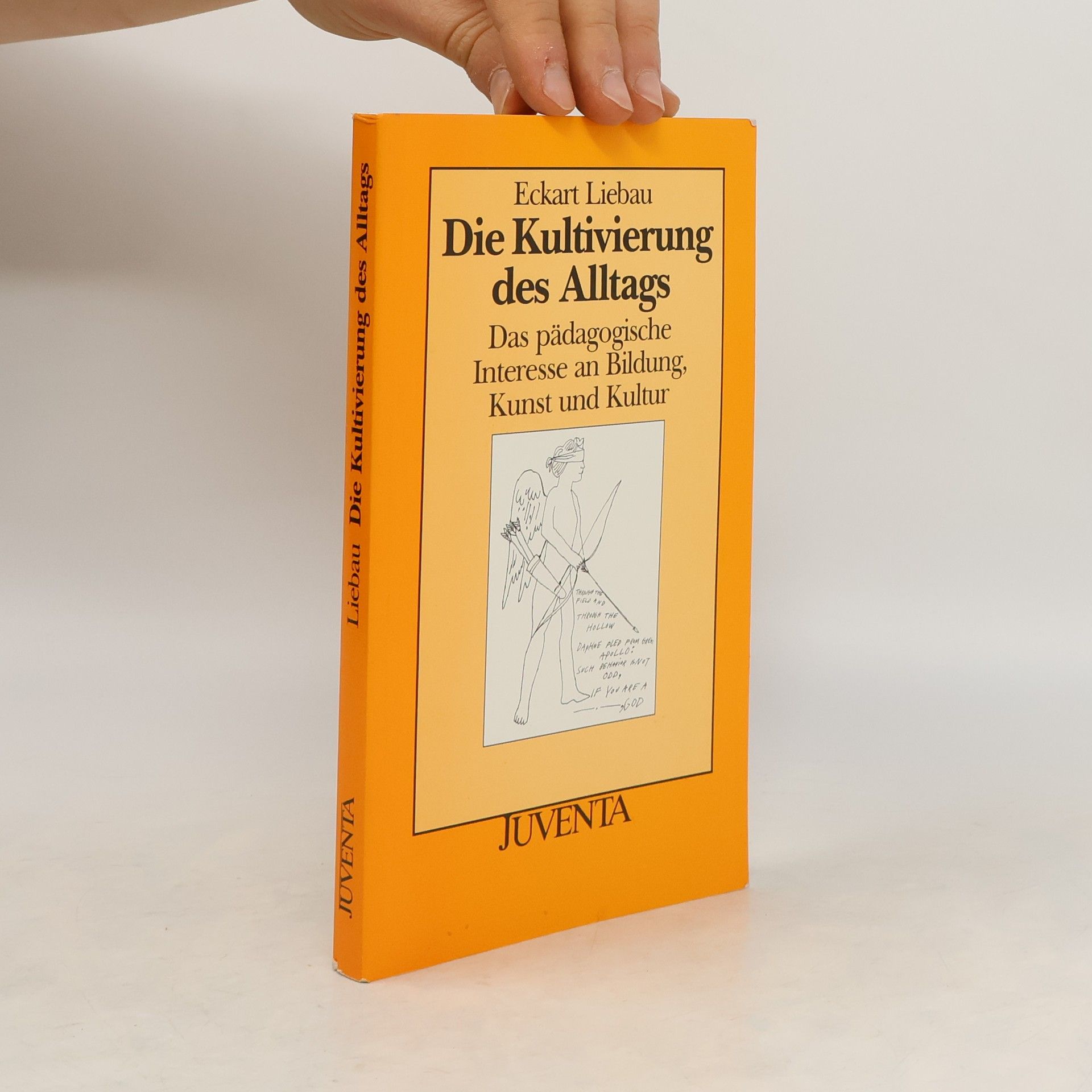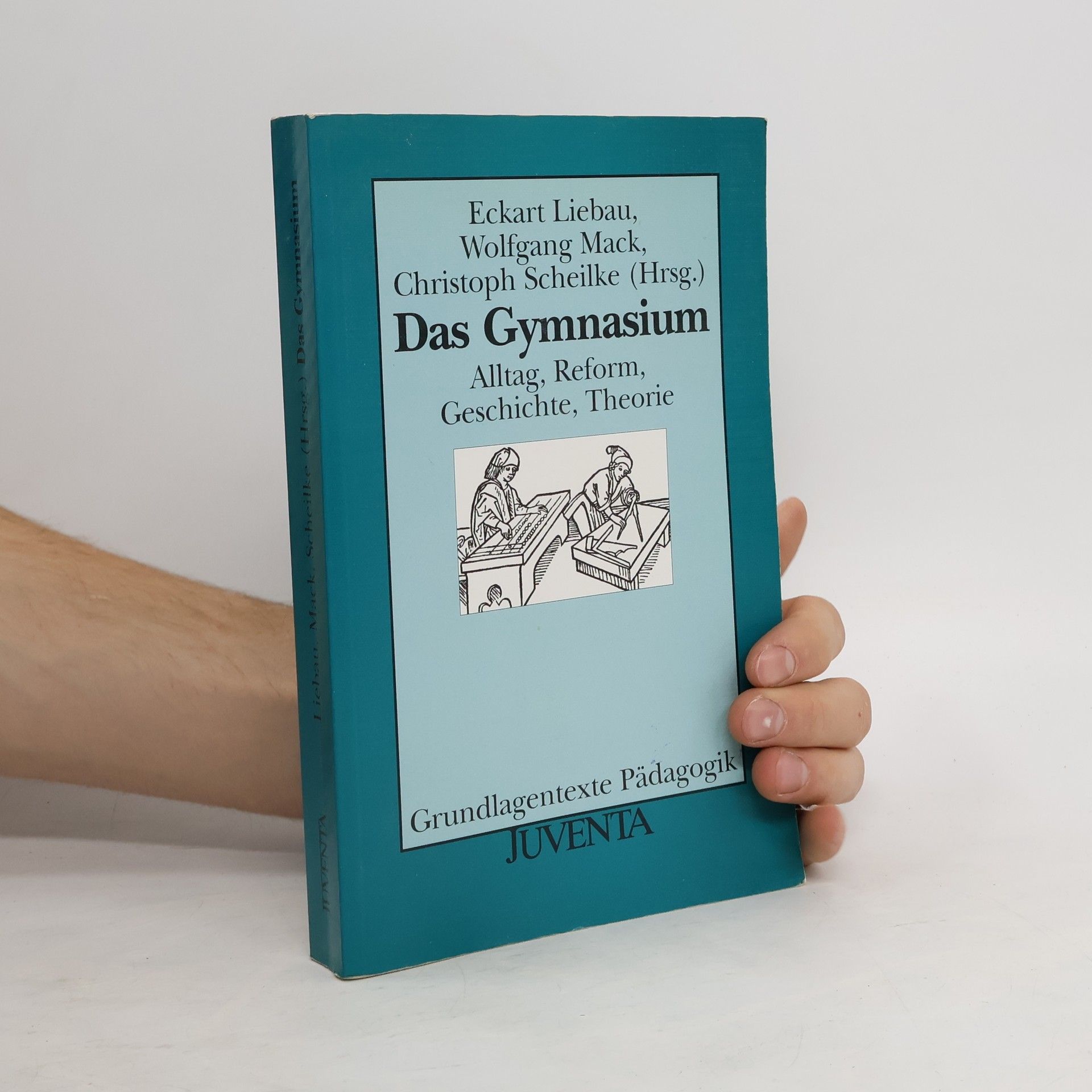Das Gymnasium
- 388bladzijden
- 14 uur lezen
Die Bezeichnung „höhere Volksschule“ wird in der öffentlichen Diskussion über das Gymnasium häufig in pejorativer Bedeutung verwendet. Es ist aber ein Ehrentitel für eine Schulform, die den schwierigen Weg von einer ständisch geprägten Elitenschule zu einer demokratischen höheren Massenschule bisher schon auf höchst erstaunliche Weise bewältigt hat. Denn ohne Zweifel ist das Gymnasium der Hauptgewinner der Bildungsexpansion der letzten dreißig Jahre. Seine Attraktivität ist ungebrochen. Mancherorts liegen die Übergangsquoten bei über 50%. Hier liegt jedoch zugleich ein zentrales Problem des modernen Gymnasiums. Denn die traditionelle Gymnasialkultur passte zwar gut zu einer Ausbildungsstätte einer kleinen Elite, zur heutigen gymnasialen Massenschule passt sie hingegen kaum. Der Herausforderung, die sich aus der Diskrepanz zwischen dem überkommenen gymnasialen Schulkonzept und der heutigen, sehr heterogenen gymnasialen Schülerschaft ergibt, müssen die Schulen sich stellen. Dieser Band trägt dazu bei, dass das Gymnasium ein neues, zu seiner empirischen Situation passendes pädagogisches Selbstverständnis entwickeln kann und regt zugleich die wissenschaftliche Diskussion an. Erfahrungen aus dem Schulalltag, Berichte über Reformansätze, Darstellungen zu den historischen, soziologischen und politischen Hintergründen und bildungstheoretische Erörterungen zeichnen ein Bild von Gegenwart und Perspektive für das Gymnasium.